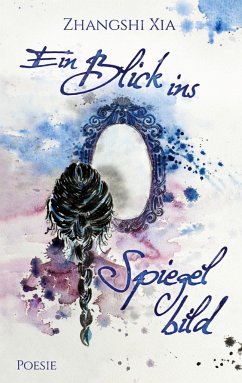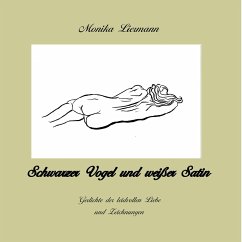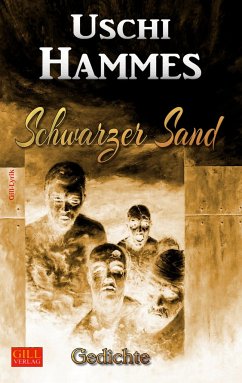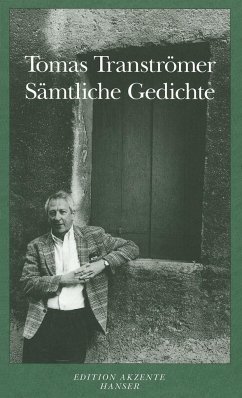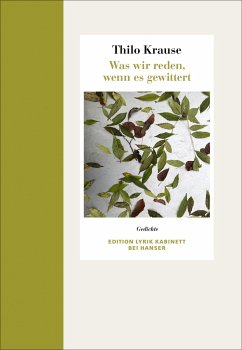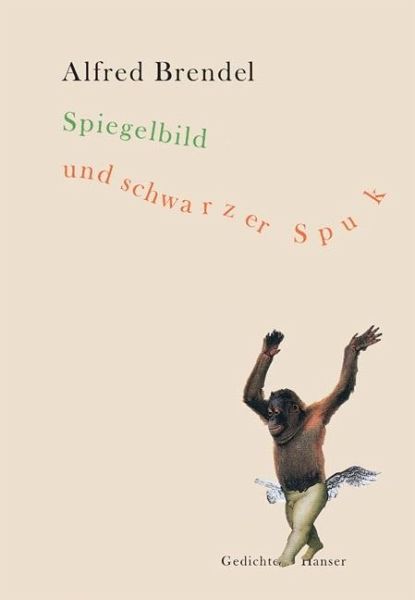
Spiegelbild und schwarzer Spuk
Gesammelte und neue Gedichte
Illustration: Neumann, Max; Murschetz, Luis; Pastior, Oskar
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
21,90 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Der Pianist als Dichter: Mit seinen komischen und grotesken Versen baut Alfred Brendel eine luftige Brücke zwischen Sinn und Unsinn. So wird bei ihm Beethoven (der, was auch ziemlich unbekannt ist, ein Neger war) als Mörder von Mozart entlarvt oder die bewegende Frage erörtert, was geschah, als Brahms sich in den Finger geschnitten hatte. In Brendels Gedichten - von denen sämtliche in diesem Band versammelt sind - kommt alles und jeder zur Sprache, sogar ein Speckschwein, das am Telefon grunzend seine Lebensgeschichte erzählt.