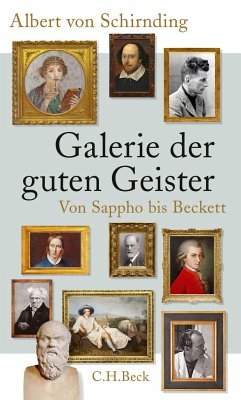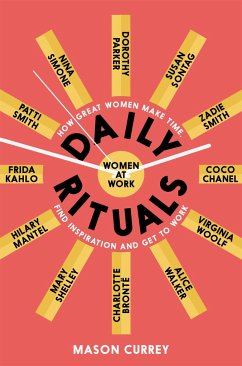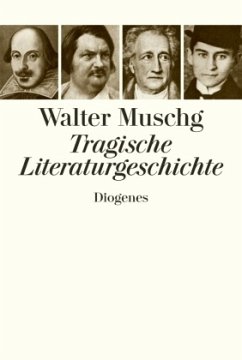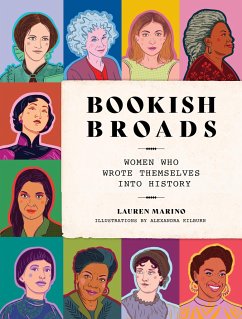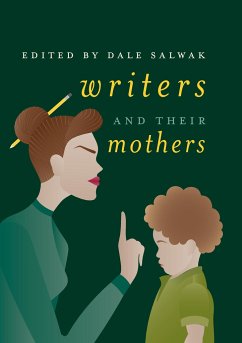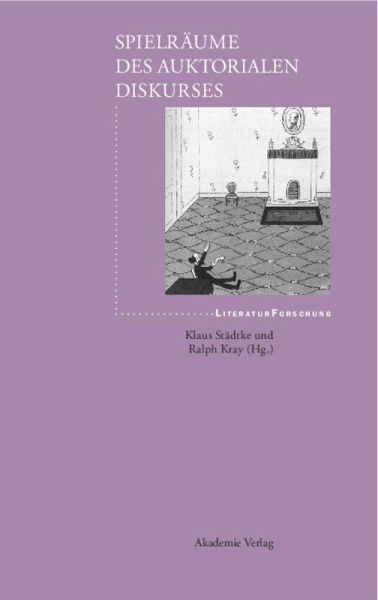
Spielräume des auktorialen Diskurses
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
94,95 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die wissenschaftliche Analyse literarischer Autorschaft bewegt sich in einem Spektrum zwischen personalen Zuschreibungen und gesellschaftlich-diskursiven Bedingungszusammenhängen: zwischen 'Urheberschaft' und 'Autorität'. Beide Aspekte, so Wolfgang Iser im vorliegenden Band, "stehen nicht in wechselseitiger Deckung", so daß einseitig erzähltheoretische, subjektphilosophische, soziologische oder individualpsychologische Zugänge nur zu einer perspektivischen Verzerrung führen können. Deren Symptom ist nicht zuletzt die seit den späten sechziger Jahren kontrovers geführte Diskussion über Tod, Verschwinden und Wiederkehr 'des Autors', in der sich Standpunkte der Hermeneutik und Diskursanalyse bisher weitgehend unvermittelt gegenüberstehen.
Die Beiträge dieses Bandes stellen sich jenem Dilemma, indem sie die Verflechtung heterogener Faktoren und die daraus hervorgehenden, historisch mehr oder weniger flexiblen Spielräume des auktorialen Diskurses diskutieren, die dem individuellen Schreibakt vorausliegen und zugleich von ihm mitgeprägt werden. Gegenstand der historischen wie systematischen Untersuchungen sind die heterogenen Konstitutionsbedingungen von Autorschaft, Probleme der Repräsentation von Auktorialität im literarischen Text sowie die Zusammenhänge von Literatur und Autorität im weiten Sinne (Kanonisierungsprozesse und Kanondebatten, Medienkonkurrenz). Die Aufsätze zu einer Reihe von Einzelautoren (Flaubert, Tennyson, Dostoevskij, Doderer, Nabokov u. a.) verstehen sich vor allem als Fallstudien zur Konstitution und De(kon)struktion von Auktorialität in der neueren europäischen Literatur- und Mediengeschichte.
Mit Beiträgen von Ingo Berensmeyer, Wolfgang Iser, Wolfgang Stephan Kissel, Ralph Kray, J. Hillis Miller, K. Ludwig Pfeiffer, Gerhard Plumpe, Klaus Reichert, Ulrich Schulz-Buschhaus, Klaus Städtke, Franziska Thun-Hohenstein und Carsten Zelle.
Die Beiträge dieses Bandes stellen sich jenem Dilemma, indem sie die Verflechtung heterogener Faktoren und die daraus hervorgehenden, historisch mehr oder weniger flexiblen Spielräume des auktorialen Diskurses diskutieren, die dem individuellen Schreibakt vorausliegen und zugleich von ihm mitgeprägt werden. Gegenstand der historischen wie systematischen Untersuchungen sind die heterogenen Konstitutionsbedingungen von Autorschaft, Probleme der Repräsentation von Auktorialität im literarischen Text sowie die Zusammenhänge von Literatur und Autorität im weiten Sinne (Kanonisierungsprozesse und Kanondebatten, Medienkonkurrenz). Die Aufsätze zu einer Reihe von Einzelautoren (Flaubert, Tennyson, Dostoevskij, Doderer, Nabokov u. a.) verstehen sich vor allem als Fallstudien zur Konstitution und De(kon)struktion von Auktorialität in der neueren europäischen Literatur- und Mediengeschichte.
Mit Beiträgen von Ingo Berensmeyer, Wolfgang Iser, Wolfgang Stephan Kissel, Ralph Kray, J. Hillis Miller, K. Ludwig Pfeiffer, Gerhard Plumpe, Klaus Reichert, Ulrich Schulz-Buschhaus, Klaus Städtke, Franziska Thun-Hohenstein und Carsten Zelle.