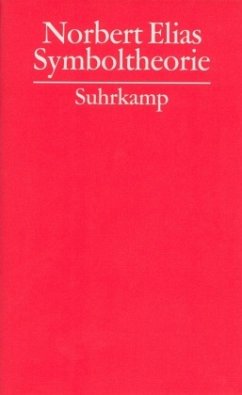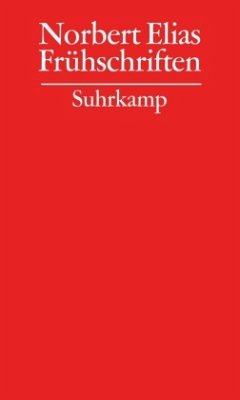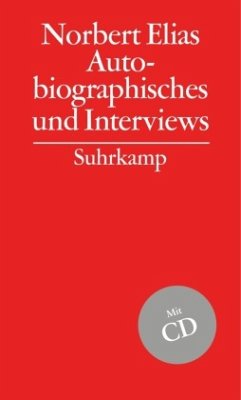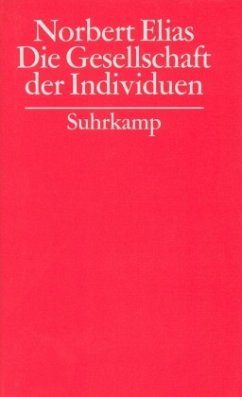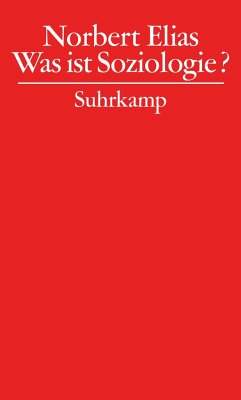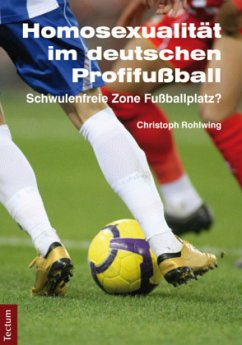Sport und Spannung im Prozeß der Zivilisation / Gesammelte Schriften 7
Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen
Mitarbeit: Blomert, Reinhard;Übersetzung: Bremecke, Detlef; Hopf, Wilhelm; Nippert, Reinhardt P.
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
34,90 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Mit diesem Band liegt erstmals die lange erwartete Übersetzung von Quest for Excitement vor, aus der im Deutschen bisher nur wenige Kapitel veröffentlicht waren. In Zusammenarbeit mit dem Sportsoziologen Eric Dunning skizziert Elias hier die Geschichte der Bändigung der Angriffslust im Sport. Die Texte handeln vom griechischen Ringen, von der Fuchsjagd englischer Gentlemen, von mittelalterlichen Formen des Ballspiels bis zum heutigen Fußball mit seinen gelegentlichen Gewaltausbrüchen im Publikum. Eine Vielzahl detaillierter historischer Beschreibungen bildet die Grundlage, auf der die Aut...
Mit diesem Band liegt erstmals die lange erwartete Übersetzung von Quest for Excitement vor, aus der im Deutschen bisher nur wenige Kapitel veröffentlicht waren. In Zusammenarbeit mit dem Sportsoziologen Eric Dunning skizziert Elias hier die Geschichte der Bändigung der Angriffslust im Sport. Die Texte handeln vom griechischen Ringen, von der Fuchsjagd englischer Gentlemen, von mittelalterlichen Formen des Ballspiels bis zum heutigen Fußball mit seinen gelegentlichen Gewaltausbrüchen im Publikum. Eine Vielzahl detaillierter historischer Beschreibungen bildet die Grundlage, auf der die Autoren eine soziologische Theorie der Entwicklung von Sport und Spiel im Zusammenhang mit dem Zivilisationsprozeß entfalten. Warum verbringen die Menschen ihren Feierabend und das Wochenende mit Sport? Welche Impulse sind an dieser Lust am Sport beteiligt? Welche seelischen Bedürfnisse und Neigungen bestimmen das spezifische Verhalten in der Sportgruppe und die dort ausgeübte körperliche Gewalt? Warum ist Sport männerdominiert? In einer Zeit, in der Sport eine immer größere Rolle in der Gesellschaft spielt, sind diese Fragen über den Geist des Sports von unmittelbar erkennbarer Relevanz.