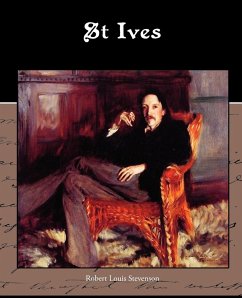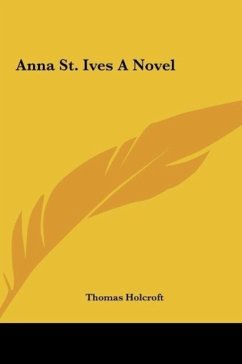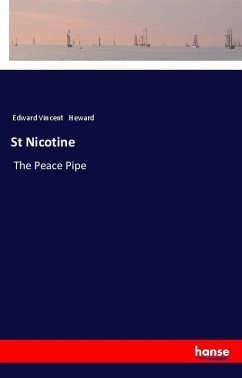Robert Louis Stevenson was a 19th century Scottish essayist, poet, novelist, and travel writer. His most famous works are Kidnapped, Dr Jekyll and Mr. Hyde, and Treasure Island. St. Ives: Being The Adventures of a French Prisoner in England (1897) is an unfinished novel by Robert Louis Stevenson. Arthur Quiller-Couch completed the novel in 1898. Captain Jacques St. Ives is a Napoleonic soldier who has been captured by the British.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Die Angelsachsen schmähten ihn lang als Kolportage-Schreiber, dabei ist Robert Louis Stevenson ein Erzähler von Weltformat. Sein Abenteuerroman "St. Ives" ist sensationell - zu Wasser, auf der Erde und in der Luft.
Im Jahr 1914, so teilt uns Andreas Nohl in seinem Nachwort mit, schrieb "ein Mann namens Swinnerton ein Buch von über 200 Seiten, um darzulegen, dass Stevenson ein zweitklassiger Schriftsteller sei". Das war zwanzig Jahre nach dem Tod des zu Lebzeiten hochgeschätzten Autors. Nicht lange danach senkt Bloomsbury den Daumen nach unten: Virginia und Leonard Woolf hauen in die gleiche Kerbe. Schließlich wird Stevenson in Großbritannien gleichsam aus der Literatur exkommuniziert: In der Oxford Anthology of English Literature aus dem Jahr 1973 fehlt sein Name ganz. Man kann sich das höchstens mit der berühmten Floskel vom Propheten im eigenen Land erklären (und vielleicht noch dadurch, dass der Mann Schotte war), und keine Wertschätzung durch berühmte Kollegen wie Mallarmé, Chesterton, Nabokov oder Brecht schien bis heute viel daran ändern zu können. Der angelsächsischen akademischen Rezeption fällt es offenbar schwer, einen Autor einzuordnen, der in so vielen verschiedenen Genres gearbeitet hat, und deshalb hat sie ihn lieber gleich ganz entsorgt.
Allerdings gibt es seit einiger Zeit auch Gegentendenzen, so beispielsweise eine neuere amerikanische Untersuchung, die sein Werk auf Parallelen zu dem Joseph Conrads analysiert und im Untertitel "Writers of Transition" heißt. Da ist man schon mal auf der richtigen Spur. Wer zum Beispiel Stevensons "Die Ebbe" liest, ist so weit nicht mehr vom "Herz der Finsternis" entfernt.
"St. Ives" ist der letzte Roman von Robert Louis Stevenson, falls man das so eindeutig sagen kann bei einem Autor, der immer mit mehreren Projekten auf mehreren Baustellen gleichzeitig beschäftigt war. Er hat ihn nicht vollenden können, so dass wir die letzten sechs Kapitel auf Basis des schon ausgearbeiteten Konzepts dem zwanzig Jahre jüngeren Kollegen Arthur Quiller-Couch verdanken. Wenn einmal der inflationär gebrauchte Begriff "kongenial" zutrifft, dann hier: Weder ein stilistischer noch ein erzähltechnischer Bruch ist in diesen letzten Kapiteln zu spüren.
Es handelt sich um einen Abenteuerroman nach allen Regeln der Kunst: mit Sensationen zu Lande, in der Luft und zu Wasser, in dieser Reihenfolge. Der Abenteuerroman ist ein moderner Abkömmling des Ritterromans, und der Held dieses Epos, der französische Junker Kéroual de Saint-Yves, Kriegsgefangener in Edinburgh zur Zeit der Napoleonischen Kriege, muss folgerichtig, unter Einsatz seines Lebens, eine Menge Âventiuren bestehen und vor der schönen Frau zunächst einmal einen Goldschatz erobern. Da die Zeit der Ritterromane um die vorletzte Jahrhundertwende aber schon lange vorbei war, haben in diesem Roman auch zwei Rechtsanwälte entscheidende Positionen besetzt und verweisen so ironisch auf die Verrechtlichung des modernen Lebens. Der Goldschatz liegt nämlich nicht irgendwo vergraben, sondern hat die Form einer Erbschaft.
Der Reihe nach: Der französische Adelige, der unter dem Namen Champdivers als einfacher Mannschaftsdienstgrad in Napoleons Armee dient und eigentlich ein Spion ist, gerät in Kriegsgefangenschaft, ist auf der Festung Edinburgh inhaftiert, verliebt sich in ein schottisches Mädchen namens Flora, das zusammen mit seiner Tante die Gefangenen zuweilen besucht. Er flieht mit seinen Kameraden aus der Festung, geht dann eigene Wege, wobei er sich in Anlehnung an seinen französischen Adelsnamen St. Ives nennt.
Zunächst geht es, verbunden mit abenteuerlichen Kutschfahrten, über die Grenze nach England zu seinem Erbonkel, der schon nach der Revolution Frankreich verlassen hat. Es versteht sich von selbst, dass St. Ives auf dem Weg in den englischen Süden nicht nur etliche Gefahren zu bestehen hat, sondern dass ihm auch ein schon lange in England lebender Cousin, ebenfalls ein Spion, die Erbschaft streitig machen will und bis zum Ende mit den unlautersten Mitteln darum kämpfen wird. Vor Ort handelt St. Ives sich einen Kammerdiener namens Rowley ein, ein Prachtexemplar von einem jungen Mann, und dann geht es unter nicht geringerer Gefahr zurück nach Edinburgh, denn schließlich soll Flora gefreit werden. Bis es dazu kommt, müssen weitere Prüfungen bestanden werden, darunter eine irrwitzige Ballonfahrt, Abenteuer auf See auf einem angeblichen Freibeuterschiff und eben mal ein kurzer Besuch in Paris, zum selben Zeitpunkt, als der Kaiser der Franzosen abdankt. 465 Seiten braucht es, bis das Happy End erreicht ist, und jede einzelne davon ist die Lektüre wert.
Stevenson wusste eben schon lange vor Ernst Bloch, dass der Roman eine unreine Mischung ist und ein kräftiger Schuss Kolportage kein Sakrileg. Die Kunst besteht unter anderem darin, selbst die größten Zufälle, an denen dieses Buch nicht arm ist, wie selbstverständlich erscheinen zu lassen. Das gelingt dem souveränen Handwerker Stevenson durchweg, indem er sie deutlich vorführt, ebenso wie die zuweilen schrille Situationskomik einzelner Szenen. Stevensons Erzähler, dieser Kéroual de Saint-Yves alias Champdivers alias St. Ives alias Mr. Ducie, ist schließlich kein tumber Tor, sondern ein Hochstapler von einigen Gnaden. Hier schreibt ein Autor, der nicht nur weiß, sondern immer wieder deutlich darauf hinweist, welche Tricks er anwendet, ohne dass ihm sein hoher Reflexionsgrad die Lust am Erzählen nimmt. Viel später hat sich die Postmoderne diese Haltung hart erarbeiten müssen, mit oft sehr viel dünneren Resultaten.
Natürlich wird der Roman auch dadurch getragen, dass Stevenson als gewohnt skrupulöser Stilist brilliert. Überwältigend allein die Chuzpe des ersten Satzes: "Schließlich hatte ich das Pech, im Mai 1813 in die Hände des Feindes zu fallen." Gottlob hat da kein Lektor die Hände überm Kopf zusammengeschlagen und gerufen, man könne einen Roman von bald fünfhundert Seiten wohl kaum mit dem Wort "schließlich" beginnen. Man kann - und hat den Leser gleichsam im Sturmangriff überrumpelt, um sprachlich in der militärischen Sphäre des Erzählers zu verbleiben. Bisher war Krieg, sagt der Satz, aber für mich ist er jetzt vorbei, und nun beginnt meine eigentliche Geschichte.
Es war überdies reichlich kühn, ein britisches Publikum mit einer Geschichte gewinnen zu wollen, die aus der Perspektive eines französischen Kriegsgefangenen in Edinburgh erzählt wird. Der Schotte Stevenson nutzt diese Erzählerposition unter anderem weidlich aus, um ab und an den Engländern eins auszuwischen. Das Bild von John Bull, das hier gezeichnet wird, ist wenig schmeichelhaft. Seine schottischen Landsleute kommen da weit besser weg, sieht man von der düster-komischen Schilderung des "schottischen Sabbats" und des überaus komplizierten Sektenwesens ab. Dass die Angebetete, um derentwillen all diese gefährlichen Abenteuer bestanden werden, eine Schottin ist, versteht sich von selbst: "... von edler Haltung und mit verschwenderischer Haarpracht, in der die Sonne Goldfäden spann". Der Roman stellt in gewisser Weise eine Heimkehr des Autors nach Schottland dar - vom fernen Samoa aus, wo er geschrieben wurde. Saint-Yves ist allerdings alles andere denn ein als Franzose verkleideter Schotte. Bei seiner durchaus vorhandenen Frankophilie gelingt Stevenson das Porträt eines wirklichen Franzosen ohne weiteres.
Andreas Nohl hat Stevensons spätes Werk in ein geschmeidiges, frisches Deutsch übersetzt. Er hat zudem ein lesenswertes Nachwort geschrieben und den Roman mit ausführlichen Anmerkungen versehen. Der ist, wie man beim Lesen schnell begreift, nicht nur ein Spät-, sondern auch ein Hauptwerk und macht schmerzlich deutlich, dass Robert Louis Stevenson mindestens zwanzig Jahre zu früh gestorben ist. So sind gewiss einige Werke der Weltliteratur ungeschrieben geblieben. Dieses hier aber gehört ihr an und sollte nun gelesen werden.
JOCHEN SCHIMMANG
Robert Louis Stevenson: "St. Ives". Roman.
Herausgegeben und übersetzt von Andreas Nohl. Carl Hanser Verlag, München 2011. 517 S., geb., 27,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main