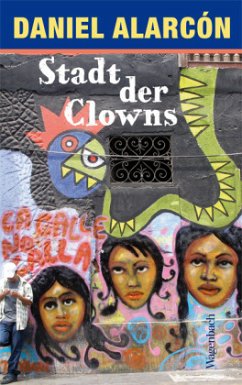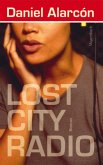Mitten in der chaotischen Millionenstadt Lima begegnen wir dem jungen JournalistenÓscar, der eine Reportage über als Clowns verkleidete Bettler schreibensoll, und dem Lastwagenfahrer Gregorio Rabassa. Wir werden Zeugen davon,wie ein junger Mann, El Pintor, sein Kunststudium abbricht und sich der Guerillaanschließt, um die Bewohner Limas mit schwarz angemalten Hunden zuerschrecken, und begleiten den zehnjährigen Maico zu seiner Arbeit an eineder dichtbefahrenen Straßenkreuzungen der Stadt, wo er sich Tag für Tag miteinem Blinden um seinen Lohn, ein paar kümmerliche Münzen, streiten muss.Wie schon in seinem großartigen Roman Lost City Radio entwirft Daniel Alarcónin seinen hochgelobten Erzählungen die Szenerie einer Stadt zwischen Verzweiflungund Hoffnung. Für Alarcón gibt es nichts Privates, das nicht zugleichpolitisch wäre und umgekehrt; das Leben und das alltägliche Überleben seinerProtagonisten - und manchmal auch ihr Sterben - spiegeln im Kleinen die ungelöstenKonflikte einer Gesellschaft im Umbruch.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Ralph Hammerthaler freut sich über die vielversprechenden Werke junger lateinamerikanischer Autoren, die in den letzten Monaten erschienen sind; Daniel Alarcón, Jahrgang 1977, sei einer von ihnen. Seine Erzählungen in "Stadt der Clowns" sind "kühl wie eine Messerklinge", findet der Rezensent. Beinahe alle Geschichten spielen in Parus Hauptstadt Lima. Der Leser bekomme es in den Geschichte vor allem mit einzelnen Menschen zu tun, "mit ihrer Einsamkeit, ihrer Unruhe und Zerrissenheit". Eine Ausnahme bildet die Geschichte "Los Miles", verrät Hammerthaler: auf nicht einmal zwei Seiten erzähle der Autor gleich von einem ganzen unterdrückten Volk, das seine Aluminium-Steppdecken-Stadt vor bedrohlichen Bulldozern beschützen will.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
» Alarcón erzählt erstaunlich souverän, mit passionierter Kühle und Genauigkeit « Wolfgang Schneider, Literaturen