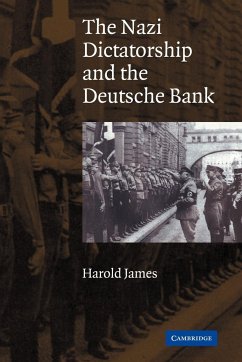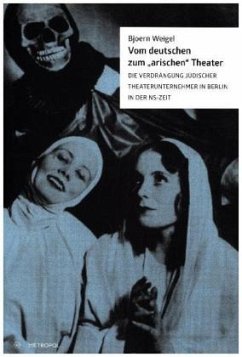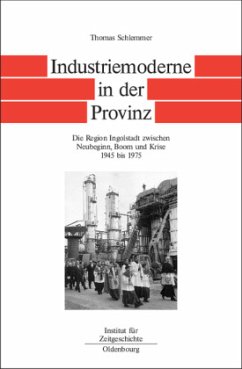Stadt der Schieber
Der Berliner Schwarzmarkt 1939-1950. Dissertationsschrift
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
59,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Am 9. November 1944 wurde die Schwarzhändlerin Martha Rebbien in ihrer Berliner Wohnung verhaftet, nachdem sie schon vier Jahre lang am Berliner Schwarzhandel teilgenommen hatte. Ihre Geschichte ist zugleich die Geschichte eines Marktes, die Geschichte seiner Teilnehmer undihrer Praktiken, der ökonomischen Makrobedingungen wie einzelner alltäglicher Anpassungsleistungen. Sie ist in erweiterter Perspektive auch eine Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner während des Krieges."Stadt der Schieber"ist eine kulturwissenschaftliche, überaus facettenreiche Analyse des Schwarzmarkts in Berlin, di...
Am 9. November 1944 wurde die Schwarzhändlerin Martha Rebbien in ihrer Berliner Wohnung verhaftet, nachdem sie schon vier Jahre lang am Berliner Schwarzhandel teilgenommen hatte. Ihre Geschichte ist zugleich die Geschichte eines Marktes, die Geschichte seiner Teilnehmer undihrer Praktiken, der ökonomischen Makrobedingungen wie einzelner alltäglicher Anpassungsleistungen. Sie ist in erweiterter Perspektive auch eine Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner während des Krieges."Stadt der Schieber"ist eine kulturwissenschaftliche, überaus facettenreiche Analyse des Schwarzmarkts in Berlin, die in der prominenten Figur des"Schiebers"einen archimedischen Punkt findet, der das Phänomen in seine lange Vorgeschichte einbettet und die Folgen des Schwarzhandels als radikale Markterfahrung nachzeichnet.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.