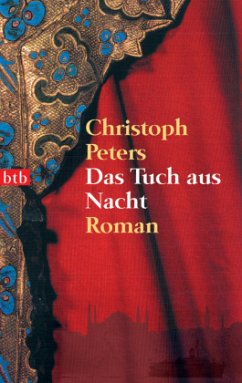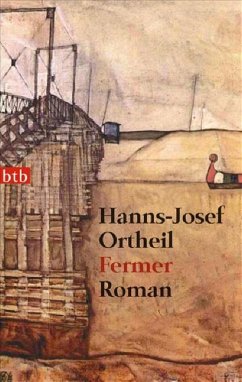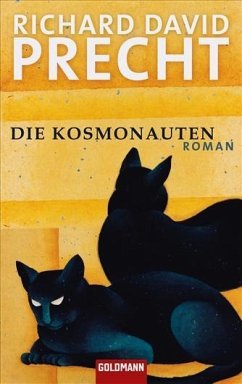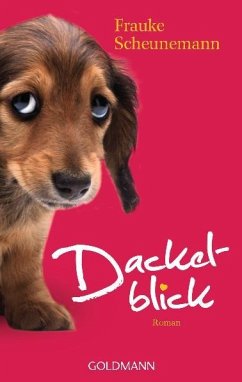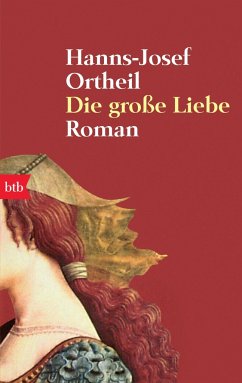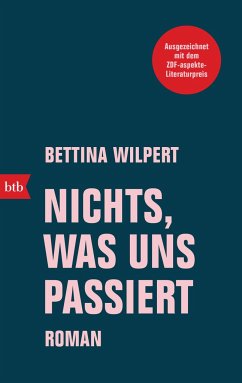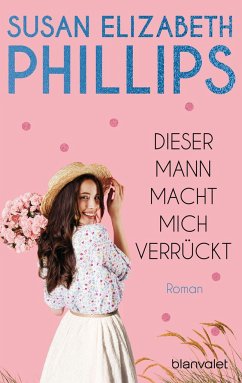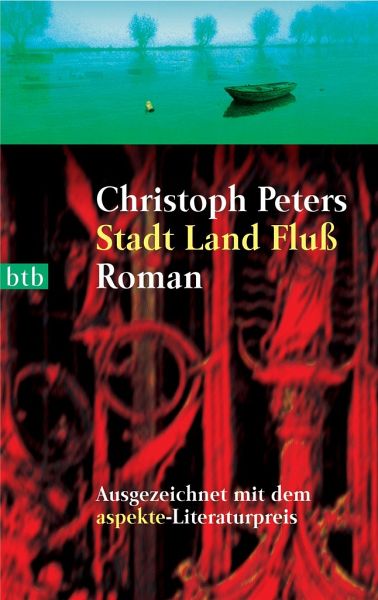
Stadt Land Fluß

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Ironisch, zärtlich und mit hintersinnigem Humor, in einer präzisen, zuweilen harten, immer poetischen Sprache, verfolgt "Stadt Land Fluß" die Geschichte der einzigartigen Liebe von Hanna und Thomas Walkenbach: den Weg der großen Gefühle durch die Banalitäten des Alltags, hinein in eine fatale Abhängigkeit, die für Walkenbach nur mit zunehmend raffinierteren Strategien des Selbstbetrugs zu bewältigen ist. Und zusehends treten die wahren Gründe für Hannas Abwesenheit zutage ...
Ausgezeichnet mit dem aspekte-Literaturpreis.
Ausgezeichnet mit dem aspekte-Literaturpreis.