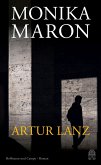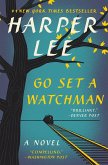Ein Männer-Debattierklub in Brownsville. Archie Feinstein, Meyer Woolf und Izzy werfen sich gut gemeinte Boshaftigkeiten an den Kopf. Spielerisch leicht und herrlich selbstironisch.1950 im Brooklyner Viertel Brownsville. Fast täglich kommen Meyer Woolf, Archie Feinstein, Izzy und ihre Freunde in Sams Cafeteria, um beim Kaffee über Gott und die Welt zu debattieren: Liebe, Ehe, Eifersucht, Alltagssorgen, Koreakrieg und Rassismus sind nur einige der Themen. Zu jedem weiß einer einen Witz zu erzählen. Einer Meinung sind die Männer selten, auch wenn ihr Jüdischsein sie verbindet. Und ständig fallen sie sich ins Wort, frotzeln, auch wenn sie sich mögen. Oder gerade deshalb.Die Schrecken antisemitischer Verfolgung haben sie alle ins amerikanische Exil geführt. Immerhin sind sie dem Schlimmsten entronnen, aber sie schleppen doch an ihrer Vergangenheit, und so amerikanisch sie sich geben, so wenig selbstverständlich ist ihnen vieles. »Steven Blooms Texte verdanken ihren Charme nicht zuletzt den punktgenauen, sehr flotten Dialogen, die an bessere Screwball-Komödien erinnern«, schrieb Ulrich Rüdenauer in einer Kritik. Silvia Morawetz hat sie brillant und stilsicher ins Deutsche übertragen.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Fachleute fürs Leben: Ein Roman von Steven Bloom
New York in der Zeit des Kalten Krieges. Im Belmore bei Bald Sam sind sie Stammgäste: Archie Feinstein, der Taxifahrer, der lieber Leichenwagen fahren möchte, Jack Goldfarb, der Zuschneider unter der Fuchtel seines Vorarbeiters, und Izzy, der Boxer mit dem Schrapnell im Kopf - der "davongekommene Jude". Aber davongekommen sind sie ja im Grunde alle, besonders die älteren wie Max Warsaw und vor allem Meyer Woolf, der am liebsten nichts Böses in den Menschen sehen möchte.
Bei Sam in der Cafeteria trifft man sich, um die Weltprobleme zu lösen, denkt zuweilen an Benny Kubbleman, der zurzeit als Soldat in Korea steht (später wird er in Vietnam sterben), oder macht sich Gedanken über die Rosenbergs, die gerade als sowjetische Spione auf dem elektrischen Stuhl gestorben sind. Richter und Ankläger, immerhin, waren Juden.
So versucht man, sich im Café-Plauderton dem Alltag einzupassen und ein guter Amerikaner zu sein, jeder auf seine Weise. Archie zum Beispiel beneidet die Großen von Hollywood, weil sie sich immer wieder wegen "seelischer Grausamkeit" scheiden lassen können - ein Privileg der Reichen offenbar, das ihm selbst in seinem ewigen Ehekampf nicht gegönnt ist. Und natürlich ist Baseball ein Dauerthema, aber bei dem begegnet man auch Typen wie Hogan, dem die Nigger und die Itziks alle "gottverdammte Kommunisten" sind.
Jeder ist Fachmann für das Leben der anderen, meint Archie. Bekenner sind er und seine Freunde samt und sonders nicht, sondern Zweifler und Melancholiker, aber was sie trägt, ist die Beruhigung, böser Vergangenheit entronnen zu sein, ergänzt durch ein gutes Maß talmudischer Weisheit, zumeist in das Gewand von einem Witz gekleidet. Das sind dann Geschichten wie die von Yankel, der auf dem Hof seinen Schlüssel sucht und wenn Chaim fragt, ob er denn sicher sei, ihn hier verloren zu haben, erwidert: "Verloren hab ich ihn auf der Straße, aber hier ist besseres Licht." "Was ihr gerade gehört habt, meine Freunde", fügt Mendel Nasab in Steven Blooms Buch hinzu, "ist die Geschichte des jüdischen Volkes." So suchen denn auch Archie, Meyer, Izzy und alle die anderen wie Irving Mandel, Mr. Lefkowitz und Mrs. Berkowitz oder die "Frau, die so viele Witze kannte", nunmehr bei besserem Licht in diesem Amerika.
Viele Witze kennt auch er selbst, Steven Bloom, der 1942 in Brooklyn geboren wurde. Seine auf den ersten Blick so leichthin erzählte Geschichte über die Stammgäste des Belmore - es ist sein dritter Roman - hat Steven Bloom allerdings in Heidelberg geschrieben, wo er seit langem lebt und amerikanische Landeskunde lehrt. Entstanden ist ein Buch, dessen Polyphonie erst beim mehrmaligen Lesen wirklich hörbar wird, und das gehört wohl zu den schönsten Komplimenten, die man einem Schriftsteller machen kann.
GERHARD SCHULZ
Steven Bloom: "Stellt mir eine Frage". Roman. Aus dem Englischen von Silvia Morawetz. Wallstein Verlag, Göttingen 2009. 160 S., geb., 16,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensentin Jutta Person fühlt sich bestens unterhalten von diesem "fein komponierten Brooklyn-Roman" von Steven Bloom, in dem es um das alltägliche Leben jüdischer Emigranten geht: Es wird unglaublich viel geredet, über scheinbar unwichtige Dinge, die aber doch sehr aussagekräftig ist. Die Rezensentin nennt das Ganze "Gesprächspingpong" und ist so angetan von diesem besonderen jüdischen Witz, dass sie am liebsten in ihrer Besprechung aufs Nacherzählen von Witzen beschränken würde. Nach Persons Meinung versteht Bloom es, "sparsame" wie "perfekte" Dialoge zu schreiben. Auch von Silvia Morawetz' Übersetzungsleistung zeigt sich die Rezensentin sehr beeindruckt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH