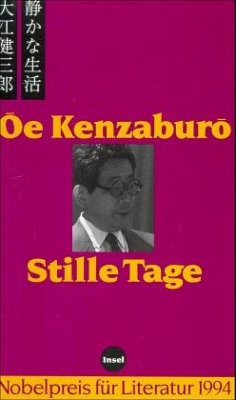Produktdetails
- Verlag: Insel Verlag
- 1995
- Deutsch
- Abmessung: 203mm x 130mm x 31mm
- Gewicht: 364g
- ISBN-13: 9783458166863
- ISBN-10: 3458166866
- Artikelnr.: 05635433
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Kenzaburô ôe betreibt das literarische Geschäft der Selbstbefragung · Von Hubert Spiegel
Seit einigen Monaten kennt man zumindest seinen Namen. Das ist nicht eben viel für einen Schriftsteller, der vor nahezu vier Jahrzehnten debütierte und seither über zwanzig Romane sowie zahlreiche Erzählungen und Essays veröffentlicht hat. Für einen Autor von Weltgeltung, der im vergangenen Jahr den Nobelpreis erhalten hat, ist es sogar ausgesprochen wenig.
Kenzaburô ôe ist in Deutschland weitgehend unbekannt geblieben, obwohl er seit langem zu den namhaftesten Schriftstellern seines Heimatlandes zählt. Bereits seine ersten noch während des Romanistikstudiums in Tokio veröffentlichten Erzählungen "Eine seltsame Arbeit", "Der Fang" und "Der Stolz der Toten" begründeten ôes literarischen Ruhm und bestimmten den jungen Schriftsteller aus der südjapanischen Provinz Shikoku zum Repräsentanten seiner Generation. Später nahm ôe in der japanischen Literatur eine Stellung ein, wie sie bei uns Heinrich Böll oder Günter Grass zukam.
Das sagt einiges über seinen Rang, aber vielleicht mehr noch darüber, warum ôe in Deutschland bislang kaum eine Handvoll Leser gefunden hat. Als "Eine persönliche Erfahrung", ôes bekanntester Roman, 1972 auf deutsch erschien, erhielt Böll den Nobelpreis, und Grass berichtete "Aus dem Tagebuch einer Schnecke". An moralischen Instanzen herrschte in der deutschen Literatur jener Jahre kein Mangel, und bis heute ist auf diesem Feld das Angebot größer als die Nachfrage. Aber daran hat es nicht gelegen.
Denn eigentlich hätte der deutsche Literaturbetrieb ôe mit offenen Armen aufnehmen müssen. Als sich die bundesrepublikanische Linke gegen die Nachrüstungsbeschlüsse stemmte, engagierte sich ôe in der japanischen Friedensbewegung. Als das Interesse deutscher Schriftsteller für politische Dissidenten in Osteuropa und anderswo wuchs, unterstützte er koreanische Oppositionelle - der Roman "Verwandte des Lebens" beginnt mit ôes Beteiligung an einem Hungerstreik für einen jungen, zum Tode verurteilten südkoreanischen Dichter. Als die Umweltbewegung die bundesdeutsche Wegwerfgesellschaft geißelte, gehörte ôe zu den Vorkämpfern des japanischen Umweltschutzes.
Aber zugleich sprach alles dagegen, ôe zu lesen. Zunächst, in den heillos politisierten frühen Siebzigern, waren seine Bücher zu privatistisch; doch zur wenig später zelebrierten neuen Innerlichkeit wollten sie auch nicht recht passen. In den achtziger Jahren, vor dem Hintergrund postmoderner Tändelei, lateinamerikanischer Fabulierlust und dem wieder lauter werdenden Ruf nach gut erzählten Geschichten, mußte der zutiefst moralische, zunehmend spröder gewordene ôe auf merkwürdige Weise anachronistisch wirken. Das geradlinige Erzählen in der Tradition des shishôsetsu, des schonungslosen autobiographischen Ich-Romans, dem er sich in den achtziger Jahren verstärkt zugewandt hatte, wirkte auf westliche Leser kunstlos, der französisch beeinflußte Existentialismus früherer Werke hatte reichlich Staub angesetzt.
Jetzt hat der Verlag Volk & Welt unter dem Titel "Der kluge Regenbaum" vier Erzählungen ôes versammelt, im Insel Verlag ist der Roman "Stille Tage" erschienen, und die edition q bringt den Roman "Verwandte des Lebens", der in dieser Zeitung als Fortsetzungsroman zu lesen war. Drei Bücher von etwa dreißig bis vierzig, die ôe in Japan veröffentlicht hat. Das ist nicht viel, aber doch genug für eine Stichprobe. Der Nobelpreis mag noch immer eine Empfehlung sein; als einziger Grund, einen weltberühmten Autor zu lesen, den niemand kennt, reicht er kaum aus.
"Vor zehn Jahren war ich achtzehn, wog knapp einen Zentner, hatte gerade das College bezogen und hielt Ausschau nach einer stundenweisen Beschäftigung." Der japanische Romanistikstudent, der hier erzählt, braucht Geld, denn er will sich unbedingt Romain Rollands Romanzyklus "Verzauberte Seelen" kaufen. Obwohl er kein Wort Russisch spricht, hat er sich die "Moskauer Ausgabe" in den Kopf gesetzt. Offenbar stolz auf solche Grillen, fragt er nicht nach den Gründen - "ich sah keinen Grund zur Besorgnis, solange ich nur hinreichend besessen war".
Ein Bankdirektor engagiert den Studenten als Gesellschafter seines Sohnes D. Der junge Komponist unterhält sich mit einem merkwürdigen Wesen, das nur er allein sehen kann: Agui, so nennt D. seinen unsichtbaren Besucher, ist ein "känguruhgroßes Baby in weißem Baumwollnachthemd". Nach einer Weile erfährt der Student von der geschiedenen Frau des Komponisten, was es mit Agui auf sich hat. Es ist der Geist ihres gemeinsamen Sohnes, der mit einem Hirnschaden geboren wurde. Der Arzt sagte dem entstellten Kind ein "pflanzenhaftes Dasein" voraus und half dem entsetzten Vater, den Säugling zu töten.
Bald muß der Erzähler erkennen, daß er nicht als Gesellschafter, sondern als Wärter seines schuldgeplagten, suizidgefährdeten Schützlings angestellt wurde. Bei einem gemeinsamen Ausflug fällt der Komponist seinen Wahnvorstellungen zum Opfer. In einer plötzlichen Bewegung, mit ausgestreckten Armen, als wollte er jemanden ergreifen, wirft sich D vor einen Lastwagen. Wollte er Agui retten oder das "Himmelsungeheuer" mit in den Tod reißen? Oder war die Wahnvorstellung, wie der Student befürchtet, nur vorgetäuscht und der Selbstmord von Anbeginn geplant?
Die Erzählung "Agui, das Himmelsungeheuer" stammt aus dem Jahr 1964, in dem auch "Eine persönliche Erfahrung" erschienen ist. Der Roman beschreibt den Schock eines jungen Vaters bei der Geburt seines geistig behinderten Kindes von "pflanzenhafter Existenz". Bird, wie der junge Vater genannt wird, will seinen mißgestalteten Sohn zunächst mit Hilfe des Arztes töten, entscheidet sich aber nach Tagen der Gewissensqualen und sexueller Exzesse, das Kind aufzuziehen. Während der Roman den qualvollen Entscheidungsprozeß darstellt, imaginiert die Erzählung, was hätte passieren können, wenn Bird sich gegen das Kind entschieden hätte.
Kenzaburô ôe muß sehr nahe daran gewesen sein, Hikari, seinen 1963 mit einer Gehirnhernie, einer unheilbaren Anomalie des Schädelknochens, geborenen Sohn, töten zu lassen. Dem Schock über die Anomalie des Kindes folgte ein ungleich größeres Entsetzen - das des Vaters über sich selbst. Es wurde zum eigentlichen Antrieb eines literarischen Werkes, das ausgeprägte Züge eines Sühneopfers aufweist. ôe vollzieht in seinen Büchern die Buße eines Vaters, der seinen Erstgeborenen töten wollte und nun sein Leben dem kranken Kinde weiht.
Hikari sei sein Lebensthema, hat ôe gesagt und sich selbst als "stellvertretenden Sprecher" seines Sohnes beschrieben. Aber in allen seinen Büchern, zumindest soweit sie auf deutsch vorliegen, bleibt das behinderte Kind, bei aller Sympathie, die ôe zu wecken vermag, dem Leser letztlich fremd. Hikaris äußeres Verhalten wird beschrieben, aber nicht durchleuchtet. Seine Wahrnehmungen, Empfindungen und Bewußtseinszustände bleiben auf auffällige Weise ausgespart. Die Achtung vor der Andersartigkeit dieses Kindes, vor der existentiellen, der Behinderung geschuldeten Fremdheit seines Denkens und Fühlens, bleibt größer als das Verlangen des Vaters, der Erfahrungswelt Hikaris Ausdruck zu verleihen.
Zugleich, von ferne nur, aber doch auf beklemmende Weise, erinnert ôes Werk an das Rousseaus. Nicht nur an die "Confessions", sondern auch an den "Emile". Aus ihm erfahren wir nur wenig über das Kind, aber alles über seinen Erzieher. Vielleicht ist es dieser Rousseausche Hochmut, der an Kenzaburô ôe zumindest befremdet. Es ist der Hochmut dessen, der in der quälerischen Selbstbefragung, im schonungslosen Geständnis, in der peinlichen Selbstentblößung immer auch das Geschäft der Selbsterhöhung betreibt. Jede Aufrichtigkeit nährt so den Verdacht der Heuchelei.
Kenzaburô ôe ist dieser Zug seines Werks und seiner Persönlichkeit keineswegs entgangen. Er beschreibt ihn sogar. Dazu nimmt der Autor die Perspektive eines Familienmitgliedes ein. Der Roman "Stille Tage" erzählt sechs Episoden aus dem Leben der drei Kinder ôes, die allein in Tokio zurückgeblieben sind, während die Eltern sich für acht Monate in den Vereinigten Staaten aufhalten, wo der Vater einen Lehrauftrag angenommen hat. Anlaß der Reise ist eine jener berüchtigten "Krisen", die ôe nur bewältigen kann, wenn er weit weg von zu Hause und in der Nähe von Bäumen ist. Weil diese Krise besonders heftig scheint - sie ist, anders als die vorangegangenen, weder mit Unmengen von Alkohol noch mit japanischen Bäumen zu bekämpfen -, läßt sich ôe erstmals von seiner Frau begleiten.
Mâ-chan bleibt mit dem älteren Bruder Hikari und ôes jüngstem Sohn ô-chan zurück. Das unsichere und verschlossene Mädchen führt während der Abwesenheit der Eltern ein "Familientagebuch", in das die Geschehnisse und Gespräche, aber auch Träume, Reflexionen und Briefe der Eltern Eingang finden. Während ô-chan ein selbständiges Leben führt, ist Mâ-chan ähnlich auf Hikari fixiert wie ihr Vater, der ihr immer fremd geblieben ist. Die Ich-Erzählerin kommentiert die Situation der Geschwister mit unverhohlenem Spott: "Wir haben weder Mutter noch Vater. Die beiden sind nach Kalifornien gegangen und beschäftigen sich mit der Seele."
Die Krise des Vaters, eine Schreib- und Lebenskrise des Schriftstellers ôe, wird zum Prüfstein für die Kinder. In einfachen, oft umständlich und unbeholfen wirkenden Worten berichtet eine wohlerzogene, überaus höfliche Zwanzigjährige von Hikaris Musik- und Schwimmunterricht, ô-chans Prüfungsvorbereitungen, der Beerdigung eines Onkels, einer Diskussion der Geschwister über Tarkowskijs Film "Stalker" und die eigenen Céline-Studien an der Universität. Mâ-chans Familientagebuch beschreibt, wie die Geschwister an den Anforderungen der Situation wachsen und erkennen, was sie selbst zu leisten vermögen, aber auch, daß sie sich aufeinander verlassen können. Auch Hikari, der hier wie in früheren Büchern ôes wieder I-Ah gerufen wird, ein Kosename, den er dem hypochondrischen Esel aus Milnes Kinderbuch "Pu der Bär" verdankt, zeigt sich verständiger und belastbarer als erwartet.
Die Familienkonstellation scheint verändert. Der Vater, der dem Mädchen einfühlsam, aber "doch irgendwie egoistisch" erscheint, der zuviel trinkt, Zoten reißt und unfähig ist, bei wichtigen Familienangelegenheiten anders als "in spaßigem oder irgendwie seltsam verdrehtem Ton" zu sprechen, der egozentrisch, verantwortungslos und unreif sich seinen Krisen überläßt und vergißt, daß er eine Familie hat, hatte zunächst wenig Gnade in den Augen seiner Tochter gefunden. Mâ-chans Verständnis wächst, als sie erkennt, daß es in ihrer Familie zwei Sorgenkinder gibt.
Nun sieht Mâ-chan auch Hikari und seine Funktion für die ganze Familie mit anderen Augen. Sie macht sich Vorwürfe, den Bruder ausgenutzt zu haben. Aber noch die Worte der Selbsterkenntnis, die Kenzaburô ôe seiner Tochter in den Mund legt, sind auf den Schriftsteller und sein Werk gemünzt: "Aber irgendwann einmal habe ich angefangen, seine Behinderung wie eine Fahne vor mir her zu tragen."
Die Kritik der Tochter ist die Selbstkritik des Vaters, die Erkenntnis der Ich-Erzählerin ist die Einsicht des Schriftstellers in die eigene Rolle: Der Idiot der Familie, um mit Sartre zu sprechen, der großen Einfluß auf den frühen ôe hatte, ist nicht der Sohn, sondern der Vater. Das Werk der Buße ist auch das Unternehmen der Selbsterforschung. Nicht nur Hikari, vor allem Kenzaburô gilt hier die grundlegende Frage aus Sartres Flaubert-Buch: "Was kann man von einem Menschen heute wissen?"
Auch für den autobiographisch grundierten Roman "Verwandte des Lebens" bildet diese Frage den Ausgangspunkt. ôe erzählt darin die Geschichte eines weiblichen Hiob, der alle Prüfungen besteht und schließlich als Heiliger verehrt wird. Zusammen mit der Geschichte Marie Kurakis, deren geistig behinderter Sohn Musan mit Hikari befreundet ist, erzählt ôe, wie ein Filmprojekt über Marie entsteht. Es stilisiert die eigenwillige, unkonventionelle Frau, die ihre letzten Lebensjahre auf einem mexikanischen Gutsbetrieb verbringt, zur "Letzten Frau der Welt". So lautet der Filmtitel, und vermutlich soll er bedeuten, daß Marie bis ans Ende aller Tage ein Vorbild bleiben wird. Was ôe und die Gruppe junger Filmemacher an Marie bewundern, ist dasselbe, was Mâ-chan an einigen Müttern behinderter Kinder so beeindruckt hat: die Bedingungslosigkeit, mit der die Herausforderungen des Schicksals angenommen werden.
Maries Prüfungen waren in der Tat ungewöhnlich schwer. Ihr Sohn Musan kommt behindert zur Welt, sein Bruder Michio muß nach einem Autounfall im Rollstuhl sitzen. Gemeinsam begehen die Brüder Selbstmord. Der Vater der Jungen, von dem Marie getrennt lebte, verfällt dem Alkohol. In einer komplexen Erzählkonstruktion, die sich immer wieder von Marie Kuraki entfernt, Szenen aus dem Leben von ôes Familie beschreibt, Briefe von Marie oder über sie zitiert und ihre Freunde zu Wort kommen läßt, beschreibt ôe den Prozeß, den Marie Kuraki durchläuft, bevor sie den Schmerz und die Trauer, Wut und Verzweiflung über die Schicksalsschläge als das begreifen lernt, was sie einem Sprichwort der Indios zufolge sind: Verwandte des Lebens.
Als Marie auf dem Krankenbett erfährt, daß ôe eine Art Drehbuch zu dem Film schreiben wird, sagt sie voraus, daß ihr Freund so über sie schreiben werde, "daß er es als seine eigene Geschichte begreifen kann". Am Ende des Buches hat Kenzaburô ôe Maries Prophezeiung erfüllt und damit ein weiteres Mal dem unauflösbaren Komplex von Schuld und Sühne, Unglück und Bewältigung nachgespürt, dem das Werk dieses Autors gewidmet ist. Es ist ein Werk, dessen Moralität universell ist, obwohl es immer nur die "eigene Geschichte" erzählt. Vielleicht fällt es deshalb so schwer, ôes Bücher zu lesen. Und schwerer noch, sie zu lieben.
Kenzaburô ôe: "Verwandte des Lebens". Roman. Aus dem Japanischen übersetzt von Jacqueline Berndt und Hiroshi Yamane. edition q, Berlin 1994. 222 S., geb., 38,- DM.
"Stille Tage". Roman. Aus dem Japanischen übersetzt von Wolfgang E. Schlecht und Ursula Gräfe. Mit einem Nachwort von Irmela Hijiya-Kirschnereit. Insel Verlag, Frankfurt am Main 1994. 236 S., geb., 39,80 DM.
"Der kluge Regenbaum". Vier Erzählungen. Aus dem Japanischen übersetzt von Buki Kim und Siegfried Schaarschmidt; aus dem Englischen übersetzt von Ingrid Rönsch. Mit einer Nachbemerkung von Siegfried Schaarschmidt. Verlag Volk&Welt, Berlin 1994. 240 S., geb., 29,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main