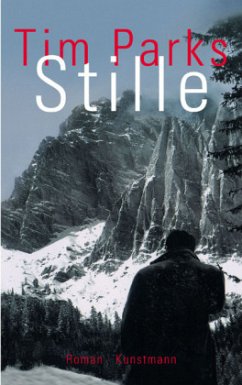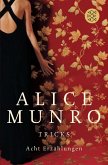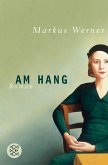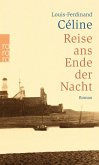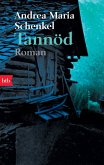Harold Cleaver ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Fernsehjournalist. Über sein denkwürdiges Interview mit dem amerikanischen Präsidenten spricht man im ganzen Land, nicht nur in London. Man spricht aber auch über das gerade erschienene Buch seines Sohnes, ein kaum verschlüsselter Roman über seinen Vater:"Im Schatten des Allmächtigen". Und plötzlich ist ihm klar, dass er weg muss. Weg von der medialen Öffentlichkeit, die er so hervorragend bedient und die ihn gleichzeitig beherrscht, weg von seiner langjährigen Lebensgefährtin und den gemeinsamen Kindern. Das Bedürfnis nach Stille ist übermächtig. Wochen später, eingeschneit in einer abgelegenen Hütte, allein und sprachlos, weil er die Sprache der Bauern nicht versteht, die ihn mit Lebensmitteln und Whisky versorgen, muss er feststellen, dass die Stille kein Garant für Ruhe ist und dass nichts so verstörend ist wie die Stimmen im eigenen Kopf.

Tim Parks spricht im Namen des Sohnes / Von Julia Bähr
Ich habe nicht das geringste Interesse", erkannte Cleaver beim Aufwachen, "am Schicksal von Tony Blair." Dieser Umstand ist deshalb bedeutsam, weil Harold Cleaver, Protagonist von Tim Parks' Roman "Stille", ein berühmter Fernsehjournalist ist, der erst vor kurzem den amerikanischen Präsidenten beim Interview vor laufenden Kameras auseinandernahm. Er wurde gefürchtet, umschwärmt und verachtet - am meisten vom eigenen Sohn, der als unerwartete Attacke ein Enthüllungsbuch über den prominenten Vater veröffentlicht hat.
Dieses Werk, eine vorwurfsvolle Aufarbeitung der problematischen Familienverhältnisse und Auseinandersetzung mit den zahlreichen Charakterschwächen Cleavers, bringt den Workaholic erst dazu, den Präsidenten mit denkwürdiger Härte anzugehen, bevor er sich überhastet in die Einsamkeit der Berge bei Luttach flüchtet. In einer abgelegenen Hütte ohne Handy-Empfang fühlt er sich wie ein freiwilliger Robinson Crusoe, der sich sowohl mit den neuen Gegebenheiten arrangieren muß als auch mit den alten Gedanken, die sich auf dem Weg in die Einöde nicht abschütteln ließen.
"Stille" ist ein episches Ein-Mann-Stück. Andere Figuren tauchen nur auf, um Cleavers Handlungen und Gedanken zu spiegeln; wirklich relevant für ihn sind nur abwesende Personen: seine haßgeliebte Lebensgefährtin Amanda, sein aufmüpfiger Sohn und seine als Teenager verstorbene Tochter, deren Verlust er nie verarbeitet hat. Daß seine Verdrängungstechnik darin bestand, sich immer jüngere, rasch wechselnde Geliebte zuzulegen, war für seine Beziehung schon nicht mehr von Belang, da die im wesentlichen auf drei Pfeilern ruht: Man läßt sich alle Freiheiten; man schätzt den intellektuellen Austausch; man führt sein gesellschaftliches Leben als aufsehenerregende Nummernrevue, deren Höhepunkt es ist, wenn die Schauspieler sich gegenseitig vorführen, gerne mit vernichtender Schlagfertigkeit bei Dinnerpartys. "Diese Show läuft schon so lange wie ,Die Mausefalle'", wird Amanda im Buch des Sohnes zitiert.
Cleaver selbst empfindet nicht nur die Streitigkeiten als inszeniert, sondern auch den Spaß in der Beziehung. Er toleriert den Liebhaber seiner Frau und erfindet selbst so viele Alibi-Redaktionskonferenzen, daß er Probleme hat, sich an alle Frauen zu erinnern, als er sie in seinem selbstgewählten Exil rekapitulieren will: "Es konnte durchaus sein, daß er zehn ausließ. Schließlich hat Cleaver noch nie zweimal hintereinander dasselbe Ergebnis erzielt. Manchmal waren es am Ende achtzig, manchmal weit über neunzig." Die spontane Eingebung, hinter der Reihenfolge seiner Affären könne eine Entwicklung stehen, die nur durch Sortieren zu erkennen sei, führt zu nichts, denn in Cleavers Gedächtnis verwischen die Erinnerungen an die Frauen. Auch wenn er Genaueres von ihnen wußte, ihre Sorgen mit ihnen besprach und sie protegierte, blieben sie doch fast alle belangloser Erinnerungsmüll, den er mit sich herumschleppen muß.
Der Punkt, an den Cleaver sich mit diesem künstlich erzeugten Stress und mit seiner Lebensweise - sein Sohn faßt sie prägnant zusammen als "Fizz aus Ficken, Völlerei und Exhibitionismus" - laviert hat, ist im Roman ein Abgrund. Da unternimmt der moderne Robinson einen nächtlichen Spaziergang am Berg, ohne Taschenlampe, was unter die Kategorie "Todessehnsucht" einzuordnen ist. Er zögert plötzlich, seinen ausgestreckten Fuß abzusetzen, und findet sich am Rande einer Schlucht wieder, in deren Tiefe ihn der Schritt gestürzt hätte. Die anschließende äußere Umkehr bedeutet innere Einkehr.
Tim Parks läßt dem Leser keine Chance, Cleavers mentalem Chaos zu entkommen. Er fesselt ihn, indem er immer mindestens drei Fäden gleichzeitig spinnt: die praktischen Erwägungen zum Leben in der Hütte, die Umwälzungen mitgebrachter Probleme und die Vorwürfe des Sohnes, die im Kopf des Patriarchen kreisen und immer wieder Anlaß zu Rechtfertigungen vor sich selbst geben. Dazwischen springen Autor und Protagonist hin und her, manchmal sogar innerhalb eines Satzes. Eine ähnlich aufmerksamkeitsheischende Methode wendet Parks mit seinem ständigen Wechsel der Perspektive an, der von der ersten bis zur dritten Person immer denselben Menschen meint. Erzähltes und Gedanken vermischen sich rasant: "Ganz plötzlich war Cleaver überzeugt, er werde sich erkälten. Du holst dir hier den Tod. Sein Nacken ist eiskalt. Warum habe ich meinen Hut nicht auf?"
Hinzu kommt eine häufig sarkastische Befassung mit dem Anspruch des offensichtlich erfolgreichen Enthüllungsromans des Sohnes, der den Titel "Im Schatten des Allmächtigen" trägt und fiktiv zu sein behauptet. Der Vater weidet jede Phrase genüßlich aus.
"Wenn ich je zurückgehe, beschloß er, dann schreibe ich an die Redaktion des ,Times Literary Supplement' und beschwere mich darüber, daß Schreiberlinge für den Booker-Preis nominiert werden, die Klischees wie ,einem Bettler einen Penny geben' verwenden", so mäkelt Cleaver an den literarischen Fähigkeiten seines Sohnes. Seine eigenen hat Tim Parks dagegen auf zwanglose Weise demonstriert. Auch wenn der Erzählfluß im letzten Drittel etwas stockt, hatte doch selten ein Buch, in dem äußerlich so wenig passierte, so kurze Längen.
Tim Parks: "Stille". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Ulrike Becker. Kunstmann Verlag, München 2006. 360 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Mit engagiertem Furor protokolliert Rezensent Sascha Michel seine Begegnung mit Tim Parks? neuem Roman, den er als Parks-typische virtuose Mischung aus Tiefsinn und Banalität, "großen Fragen" und Sinn fürs Alltägliche, psychologischer Subtilität bei der Figurenzeichnung und massenkompatiblem Erzählen nicht genug loben kann. Besonders der fettleibige Held hat es ihm angetan, Erfolgsjournalist Cleaver nämlich, der sich in einer Art verspäteter Midlife-Crisis in die Einsamkeit zurückgezogen hat. Dort wird er auf Grund einer fatalen Dialektik aus äußerer Stille und dem Lärm seiner inneren Stimmen einigen Belastungen ausgesetzt. Tom Parks scheint seine Leser ausgesprochen dicht an die komplexe Gemengelage in Innern seines Protagonisten heranzuführen. Der Rezensent jedenfalls berichtet ausgesprochen anteilnehmend vom "mentalen Desillusionsprogramm" des Protagonisten, der sich emotional noch einmal durch entscheidende, mitunter traumatische Stationen seines Lebens kämpft. Dabei trägt der Roman, schreibt Michel, so "melodramatisch dick" auf, wie sein Protagonist und ist dabei zur Begeisterung des Rezensenten doch klug genug, auf kraftmeierische Lösungsangebote in Sachen Sinnfrage und auktoriale Posen zu verzichten.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH