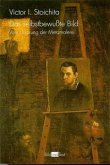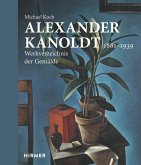Keine andere Kategorie der Kunstgeschichte, nicht einmal die Porträtmalerei, scheint auf den ersten Blick einen derart homogenen Bereich zu bezeichnen wie das Stilleben. Und das, obwohl die gesellschaftlichen Kontexte, in denen diese Kunstform sich entwickelte, kaum unterschiedlicher sein könnten. Seit jeher auch steht die Stilleben-Malerei ganz unten in der kunsthistorischen Hierarchie, oft mit Stillschweigen übergangen, in jedem Fall aber unterinterpretiert. Ausgehend von diesem Befund entwirft Bryson in dem vorliegenden Band seine Theorie untergründiger familiärer Beziehungen zwischen den Stilleben der verschiedenen Jahrhunderte. Die Gemeinsamkeiten gründen demnach in der Tatsache, daß sich in diesen Werken eine bestimmte kulturelle Praxis in ihrer unverrückbaren Materialität manifestiert, die alle Zeitspannen und nationalen Eigenheiten überdauert. Das auf solche Weise alle stilistischen Entwicklungen tragende, selbst jedoch oft übersehene semantische Fundament der Stilleben-Malerei erkennt Bryson im Ritual der Gastfreundschaft einerseits und in der Routine des häuslichen Lebens andererseits. Wie diese basale Form von Realität und materieller Existenz von komplexeren kulturellen Ebenen aus interpretiert und beeinflußt wurde, ist der Gegenstand des Buches
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Das Stillleben, weiß Valeska von Rosen, hat seit jeher einen Platz am unteren Ende der Bewertungsskala für Bildende Kunst inne, richtet es doch sein Interesse auf die scheinbar "trivialen Dinge des Lebens". Auch die theoretisch fundierte Kunstgeschichte konnte mit dem Genre zumeist recht wenig anfangen, da ein Stillleben keine narrative Struktur aufweist. Zum Glück, so die Rezensentin, gibt es Norman Brysons "höchst anregende" Studie, die Stillleben aus verschiedenen Epochen nach "konzeptuellen Bedingungen und Implikationen untersucht" und dabei dem alten Deutungsmuster der "unmittelbaren Nachahmung der Natur" neue Überlegungen entgegensetzt: Realismus sei für viele Künstler bloße "Rhetorik", so zitiert sie Bryson, die dazu diene, bestimmte Absichten zu verwirklichen, beispielsweise den "Gesichtssinn" des Betrachters anzuregen oder das Vertraute vor seinen Augen unvertraut werden zu lassen. Bestimmt hätte Rosen also die nun endlich, nach zehn Jahren, erschienene deutsche Übersetzung mit lautem Beifall begrüßt, wäre diese in ihren Augen nicht "leider gänzlich" verunglückt; der deutsche Text strapaziere "nicht nur das Sprachempfinden des Lesers", sondern sei aufgrund der sturen Wort-für-Wort-Übertragung "zum Teil schlicht unverständlich". Man greife also weiterhin zum englischen Original.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH