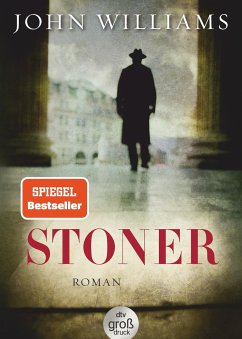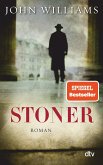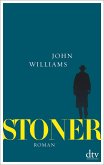»Ein zutiefst menschliches Buch über einen zutiefst menschlichen Mann.« Elke Heidenreich in 'Focus Spezial'
John Williams erzählt das Leben eines Mannes, der, als Farmer geboren, schließlich seine Leidenschaft für Literatur entdeckt und Professor wird - es ist die Geschichte eines genügsamen Lebens, das wenig Spuren hinterließ, aber auch die Geschichte eines wahrhaftigen Lebens.
John Williams erzählt das Leben eines Mannes, der, als Farmer geboren, schließlich seine Leidenschaft für Literatur entdeckt und Professor wird - es ist die Geschichte eines genügsamen Lebens, das wenig Spuren hinterließ, aber auch die Geschichte eines wahrhaftigen Lebens.

© BÜCHERmagazin, Martin Maria Schwarz (mms)
Selten war ich am Ende eines Buches so dankbar, Zeit mit der Figur, von der es handelt, verbracht haben zu dürfen. Matthias Brand, Schauspieler Die Welt 20191228
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Im 1965 publizierten Roman des amerikanischen Literaturwissenschafters und Schriftstellers John Williams regiert das Karge und das Nüchterne, berichtet die Rezensentin Angela Schader. Williams' Protagonist William Stoner bestreitet eine dürftige akademische Karriere an der Universität von Missouri in Columbia, nachdem er der elterlichen Farm entkommen ist, fasst die Rezensentin zusammen. Dazu ist er unglücklich verheirat, zuhause führt er einen Kleinkrieg mit seiner Frau Edith, der noch "der Permafrost gutbürgerlicher Sitten" anhaftet, erklärt die Rezensentin. Die einzige Tochter ist Alkoholikerin und leidet nicht minder unter ihrem eigenen Eheleben. Lichteinfälle in dieses düstere Szenario gibt es nur selten, verrät Schader, das Buch glänzt durch seine Sprache, nicht durch Gefälligkeit, findet sie. Dass es das auch im Deutschen tut, ist dem versierten Bernhard Robben zu verdanken, lobt die Rezensentin und bedankt sich beim Verlag für die treffliche Wahl.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Warum wird dieses Buch erst jetzt berühmt? Mit "Stoner" hat John Williams 1965 einen Klassiker geschrieben, der jetzt auch auf Deutsch zu entdecken ist.
Eine "amerikanische Offenbarung" nannte eine französische Zeitung John Williams' "Stoner". Der Roman war bereits 1965 erschienen; doch erst 2006 mit der Neuausgabe in der legendären Reihe "New York Review Book Classics" fand er weltweit Beachtung. C. P. Snow, der Autor von "Die zwei Kulturen", begann seine Eloge in der "Financial Times" mit dem Satz: "Why isn't this book famous?" Eine der möglichen Antworten wäre, weil die Hauptfigur, der zurückhaltende Literaturprofessor William Stoner, nicht hineinpasste in die literarische Szene der sechziger Jahre. Eine andere, weil dieser Sohn bitterarmer Farmer aus dem Mittelwesten aus der Zeit gefallen ist, geradezu einzigartig in seiner stoischen Ruhe und Schicksalsergebenheit. "Hemingway ohne Lärm", so hat ein Kritiker den Stil von Williams zu beschreiben versucht. Auf jeden Fall hat Williams eine wunderbar klare Sprache, die ohne große Worte auskommt, aber fähig ist, tiefste Empfindungen auszudrücken. Es geht um nichts Geringeres als Liebe und den Sinn und die Würde des Lebens.
John Williams (1922 bis 1994) hat Gedichte und vier Romane geschrieben - einer davon, "Augustus", wurde mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. "Stoner" ist der erste, der jetzt ins Deutsche übersetzt wurde. Williams ist wie Stoner ein passionierter Hochschullehrer gewesen. Seine Seminare und Schreibkurse waren berühmt, wie auch seine exzessiven Trinkgelage, die seine Gesundheit ruinierten. Mag sein, dass er im Universitätsbetrieb von Denver Intrigen und ähnliche Enttäuschungen erfahren musste wie sein Alter Ego in Columbia.
Den Mikrokosmos Universität, abgehoben vom Alltäglichen, eine Brutstätte von Feindschaften, aber auch eine Zuflucht, wo Wissenschaft absolute Hingabe verlangt und dafür tiefe Befriedigung schenken kann - Williams hat ihn minutiös beschrieben. Er fand hier nach den Schrecken des Krieges, die er als Pilot in Indien und Burma erlebte, zu sich selbst. Seinen Stoner lässt er allerdings, anders als dessen beide Freunde, nicht in den Krieg ziehen: "Er bringt es nicht über sich, die Deutschen zu hassen." Wie sein verehrter Lehrer Sloane ist er überzeugt davon, dass der "Krieg in einem Volk etwas tötet, das nie mehr wiederbelebt werden kann ... Der Gelehrte sollte nicht gebeten werden, das zu zerstören, was er sein Leben lang aufzubauen versucht hat."
William Stoner hat in seiner Jugend nichts anderes kennengelernt als die Arbeit auf den kargen Feldern seines Vaters, von der die kleine Familie kaum leben konnte. Und es scheint kein Ende zu nehmen mit der Schinderei: Um ein landwirtschaftliches College besuchen zu könnenen, muss er für Kost und Logis das Vieh seiner Verwandten versorgen, ehe er in seiner ungeheizten Dachkammer lernen kann. Nach zwei Semestern öffnet sich für ihn mit einem Sonett Shakespeares wie ein Wunder die Tür zu den Schätzen von Literatur und Philosophie. Endlich hat er gefunden, was er gesucht hat und was er nun beharrlich ergründen will. Er wechselt seine Studienfächer, und nachdem er sein Examen bestanden hat, erhält er auch einen bescheiden dotierten Lehrauftrag.
Es sind immer wieder die mit größtmöglicher Genauigkeit beschriebenen Bilder und Porträts, die sich einprägen, Szenen wie die beim fast wortlosen Abschied Stoners von seinen Eltern, von denen er sich unter Schmerzen entfremdet hat. Oder seine Erscheinung auf dem Campus: eine hagere, von harter Arbeit früh gebeugte Gestalt in einem abgetragenen dunklen Anzug, ein Außenseiter, der den Betrieb und jede Geselligkeit scheut, seine Pflichten aber gewissenhaft und oft mit ansteckender Begeisterung erfüllt. Ein durch und durch Bescheidener auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten, der nicht zuletzt deshalb Gelassenheit und Würde ausstrahlt.
Dass sein möglicher Aufstieg in eine höhere Gesellschaftsschicht durch die Ehe mit der Tochter eines Bankiers scheitert, ist vorauszusehen. Doch zum ersten Mal liebt er, alles andere ist ihm gleichgültig. Er versucht nur äußerlich, sich den Ansprüchen seiner Frau anzupassen. Nach einem Monat weiß er jedoch, dass er blind gewesen war, überwältigt von Gefühlen, die seine frigide Ehefrau nicht erwidert. Es gibt keinerlei Übereinstimmung zwischen den Eheleuten. Und die verwöhnte, frustrierte, zänkische Frau - sie ist nicht frei von schizoiden Zügen - entwickelt sich zu einem zerstörerischen Monster. Für Stoner beginnt ein intimes, fast lebenslanges Martyrium. Wehrlos nimmt er Demütigungen und Niedertracht hin. Selbst als die einzige Tochter, die er anfangs mit großer Liebe allein versorgt hat, von ihm ferngehalten wird, protestiert er nicht, auch nicht, als ihn seine Frau aus dem Haus drängt. Die Universitätsbibliothek und sein schmales Studierzimmer sind von nun an sein Refugium, in dem er forschen, entdecken und schreiben kann. Die großen Gestalten der Literatur werden ihm vertrauter als seine Familie und seine Kollegen an der Universität, wo nur ein einziger Freund zu ihm hält.
Mit Anfang vierzig fühlt er sich einsam und ausgebrannt. "Vor sich sah er nichts, auf das er sich zu freuen wünschte, und hinter sich nur wenig, woran er sich gern erinnerte." Doch dann wird er unerwartet durch eine neue Liebe von diesem "Gewicht der Verzweiflung" befreit. Als "Akt der Menschwerdung" empfindet er seine Vereinigung mit Katherine. Es gelingt ihm, mit ihr vertraut zu werden voller Hingabe, Zärtlichkeit und Ruhe. Sie sprechen eine gemeinsame Sprache und stimmen auch mit Lust beim gemeinsamen Lernen überein. "Wie alle Liebespaare redeten sie viel über sich selbst, als könnten sie so die Welt besser verstehen, die sie möglich gemacht hatte."
Einmal sprechen sie von ihrem Glück, doch da ahnen sie schon, dass es gefährdet ist durch die bigotte Moral der Universitätsgesellschaft in den sechziger Jahren. Vor der Zerstörung ihrer Existenzgrundlage scheuen sich beide. Selten ist eine Liebesbeziehung so zart und anrührend beschrieben worden. Sie endet lautlos und ohne jede Hoffnung im "Chaos des Möglichen". Stoner gibt Katherine auf wie sie ihn. Ihm bleibt die tröstliche Gewissheit, dass er wenigstens ein einziges Mal vollendetes Glück erfahren hat. Seine Resignation ist frei von Bitterkeit, doch sein Körper reagiert mit schwerer Krankheit. Danach vergräbt er sich mehr und mehr in seinem abgeschotteten Gelehrtendasein.
Gegen Ende seines Lebens findet er zurück zu Frau und Tochter. "Sie hatten sich das Leid vergeben, das sie einander zugefügt hatten, und betrachteten selbstversunken, was aus ihrem gemeinsamen Leben hätte werden können." Kurz vor seinem Tod zieht er ein Fazit. Er bekennt sich zu seinem Scheitern in der Ehe, aber auch zu seiner Wehrlosigkeit als Hochschullehrer gegenüber seinen intriganten Kollegen, die seine Karriere an der Hochschule verhindert hatten. Doch was er getan hat, hat er gern getan. Unfähig zu kämpfen, ist er sich doch selbst treu geblieben. Nein, er ist kein Versager, und das Eingeständnis von Schwäche ist keine Kapitulation, er behält seine Würde: "Mit plötzlicher Kraft fühlte er seine Macht. Er war er selbst, und er wusste, was er gewesen war."
John Williams ist nun als der große Unbekannte der amerikanischen Literatur entdeckt worden, sein "Stoner" gilt als Klassiker der Moderne. An der Qualität des Romans ist nicht zu zweifeln. Es sind gerade die leisen Töne und die tiefe menschliche Weisheit seines scheuen Helden, die ihn so liebenswert machen. Bleibt noch zu loben, dass der Übersetzer Bernhard Robben makellose Arbeit geleistet hat.
MARIA FRISÉ
John Williams: "Stoner". Roman.
Aus dem Amerikanischen von Bernhard Robben. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2013. 351 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»>Stoner<, das könnten wir alle sein.« Main-Echo 14.09.2013 » « Main-Echo 14.09.2013