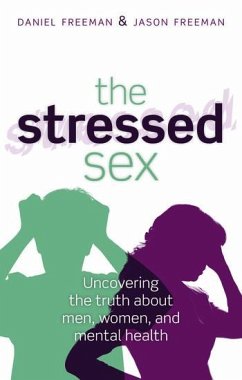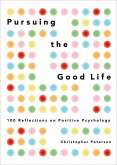Are rates of psychological disorder different for men and women? The answer to this question, and its implications, are far-reaching. Here, Daniel Freeman and Jason Freeman uncover the links between gender and mental health, drawing on the best and most up-to-date research in a variety of disciplines, to reflect on a complex and lively issue.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hausarbeit schadet der seelischen Gesundheit? Daniel und Jason Freeman trennen psychische Leiden nach Geschlechtern - politische Konsequenzen stehen noch aus
Kardiologen wissen längst, dass sie Männer- und Frauenherzen nicht über einen Kamm scheren dürfen. Orthopäden anerkennen ebenfalls, dass künstliche Gelenke für Frauen anatomisch andere Anforderungen stellen als die der Männer. Viele medizinische Disziplinen haben lernen müssen, dass für Risikofaktoren, Diagnose und Therapie geschlechtsspezifische Unterschiede zu beachten sind. Die Gendermedizin hat ihnen beigebracht, dass Frauen nicht bloße Varianten der männlichen Norm sind, sondern Kranke eigener Art.
Diese Botschaft scheint jedoch, folgt man den Argumenten von Daniel und Jason Freeman in ihrem Buch "The Stressed Sex", bei den Psychiatern noch nicht angekommen zu sein. Die beiden Brüder, Professor für Klinische Psychologie der eine und Autor von Sachbüchern und Ratgebern der andere, möchten dafür sensibilisieren, dass seelische Leiden es ebenfalls verdienen, nach Geschlechtern differenziert betrachtet zu werden.
Auch wenn es sie fast das halbe Buch kostet, so belegen sie doch mit äußerster Akribie, dass Frauen tatsächlich häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen sind. Die Autoren berufen sich auf insgesamt zwölf Studien, die sie für besonders aussagekräftig halten. Dazu zählt immerhin auch eine deutsche Untersuchung, obwohl Forscher hierzulande häufig darüber klagen, unser strenger Datenschutz vereitle die Klärung solch epidemiologischer Fragen. Die Studien belegen, dass unter Männern rund ein Viertel der Befragten über eine psychische Erkrankung im vergangenen Lebensjahr klagten, indes 37 Prozent der Frauen.
Am deutlichsten ist der Unterschied bei den Depressionen, die bei Frauen doppelt so oft vorkommen wie bei Männern. Die Freeman-Brüder widersprechen damit dem WHO-Befund, wonach psychische Störungen bei beiden Geschlechtern gleich häufig seien. Ein ausgewogenes Verhältnis betrifft offenbar nur bestimmte Geisteskrankheiten, etwa die Schizophrenie. Betrachte man Störungen wie Depression, Angsterkrankungen, Schlafprobleme oder Essstörungen, so führen Frauen eindeutig die Statistiken an. Lediglich beim Alkohol- und Drogenkonsum liegen die Männer vorn.
Aber weder die Alkoholabhängigkeit noch die Tatsache, dass Männer seltener mit psychischen Problemen zum Arzt gehen, kann wettmachen, dass Frauen weltweit die Hauptlast psychischer Störungen schultern. Es wird insbesondere deutlich, dass sich die Unterschiede bereits früh, vor allem in der Adoleszenz, manifestieren. Vornehmlich Jungen sind von dem allenthalben medial präsenten Hyperaktivitätssyndrom ADHS betroffen.
An die größere Lerndisziplin und besseren Noten der Mädchen sind wir gewohnt - sie sind als das weitaus pflegeleichtere Geschlecht in dieser Lebensphase anzusehen. Die Lektüre macht indes klar, dass dieser Schein trügt, man muss hinter die funktionierende Fassade schauen.
Nicht allein die immer noch vorkommenden Demütigungen und Beschädigungen durch sexuelle Belästigung und Missbrauch - Mädchen sind zehnmal häufiger die Opfer als Jungen - zehren an den seelischen Kräften der heranwachsenden Frauen in dieser ohnehin verletzlichen Phase. Auch die Ansprüche an das Körperbild im Zeichen des Schlankheitsideals bringen in Zeiten grassierenden Übergewichts das seelische Gleichgewicht vor allem der Frauen aus der Balance.
Sie verarbeiten Stress dabei anders als Männer, die eher zum Trinken neigen, um sich Entlastung zur verschaffen: "Men drink, women worry", lautet der griffige Slogan hierfür in der angloamerikanischen Psychiatrie. Da tröstet es nur wenig, dass bei abnehmender Stigmatisierung des Alkoholkonsums von Frauen diesen auch der Griff zur Flasche zunehmend Trost bieten darf.
Das Buch verweist auf eine Studie, wonach die Eroberung der Berufstätigkeit offenbar dem Alkoholkonsum Vorschub leistet - nach dem Motto: Wer sozial anerkannten Tätigkeiten nachgeht, darf auch trinken. So verwundert es nicht, dass in westlichen Gesellschaften der Alkoholkonsum in der weiblichen Bevölkerung erkennbar angestiegen ist. Dass die Frauen nun gerade in diesem Punkt mit den Männern gleichziehen, betrachten Ärzte indes mit Sorge, denn immer mehr Frauen trinken auch während ihrer Schwangerschaft.
Man hätte sich hier ein wenig mehr Aufmerksamkeit für die biologischen Bedingtheiten psychischer Erkrankungen gewünscht, nicht nur im Hinblick auf die Stresshormone. Gerade der fundamentale Einfluss der Sexualhormone wird doch etwas nonchalant übergangen.
Insbesondere finden die Stimmungsschwankungen etwa im Rahmen des weiblichen Monatszyklus oder während der Hormonstürme von Schwangerschaft, Stillzeit und Wechseljahren nicht die gebührende Beachtung, obwohl es hier spannende Details zu berichten gäbe. So konnte beispielsweise für Alkoholikerinnen gezeigt werden, dass bestimmte Phasen ihres Zyklus sich auf ihre Rückfallgefährdung auswirken.
Ein weiterer, sehr bedeutsamer Stressfaktor im Frauenleben ist die dauerhafte Mehrfachbelastung, da Frauen bei der Versorgung von Kindern, Alten und Haushalt die meiste Verantwortung übernehmen, inzwischen aber zunehmend berufstätig sind, hier jedoch aufgrund ungleicher Chancen nicht durch finanzielle und ideelle Anerkennung den nötigen psychischen Ausgleich erfahren. Die Autoren tappen dabei nicht in die Falle, dem politisch korrekten "Alles ist möglich" das Wort zu reden. Eine Studie mit mehr als 13 000 Teilnehmern in fünfundzwanzig Ländern förderte zutage, dass es in Europa den Frauen umso bessergeht, je mehr Wochenstunden sie im Beruf verbringen und je weniger Stunden sie auf die Hausarbeit verwenden.
Die Kehrseite dieses Befundes ist indes, dass Frauen aber immer noch dreimal mehr im Haushalt arbeiten als Männer und diese doppelt so viel Zeit auf den Beruf verwenden wie Frauen. Das rückt so manches gefühlte Urteil über Stress am Arbeitsplatz zurecht. Nicht zuletzt öffentliche Medien tragen dazu bei, dem Mobbing am Arbeitsplatz oder Burn-out im Beruf zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen als etwa den Sorgen, die Kinder oder zu pflegende Angehörige bereiten. Dadurch entsteht ein schiefer Eindruck von den tatsächlich zu Buche schlagenden Belastungen.
Solange dem politischen Lippenbekenntnis nach Anerkennung der Leistungen von Frauen als Versorgerinnen von Heim, Kindern und der älteren Generation keine Taten folgen, wird sich am Ungleichgewicht seelischer Krankheiten zuungunsten der Frauen nichts ändern.
MARTINA LENZEN-SCHULTE
Daniel und Jason Freeman: "The Stressed Sex". Uncovering The Truth About Men, Women, And Mental Health.
Oxford University Press, Oxford. 2013. 267 S., geb., 16,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main