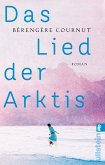Johannes Grahn reist, um sein bisheriges Leben hinter sich zu lassen, über Island in ein kleines Dorf Grönlands. Sein Leben dort verläuft in ruhigen Bahnen, bis Markus Brack auftaucht, ein Österreicher mit auffälligem Interesse für Grahns Vergangenheit. Es stellt sich heraus, dass Grahn auf seiner Hinreise in Reykjavík eine alte Freundin getroffen hatte, und dass beide eine kurze Affäre verband, bevor Agnes ums Leben kam. Die zunächst so klaren grönländischen Verhältnisse verwirren sich zusehends. Schließlich stirbt ein kleines Mädchen - und wieder war Grahn in der Nähe des Unfallorts.

Klaus Böldls Erstlingsroman "Studie in Kristallbildung"
Wie jeder Leser von "Fräulein Smilla" weiß, liegt Grönland am Ende der Welt. Aber so sehr am Ende ist nichts, daß es nicht doch noch etwas dahinter gäbe. Eine solche Hinterwelt hat Klaus Böldl zum Schauplatz seines Debütromans gemacht: Ammassalik in Ostgrönland ist ein Landstrich, von dem aus das Hauptstädtchen Nuuk wie eine ferne Metropole aussieht und der umgekehrt für die Hauptstädter jenseits der Zivilisation liegt: inmitten unermeßlicher Eisregionen ein paar Siedlungen am Fjord, in denen kein Müll mehr verrottet, in denen selbst die Friedhofsblumen aus Plastik sind und in denen man an Trunksucht oder Selbstmord stirbt, eine Gegend, deren Sozialversorgung am dänischen Tropf hängt und deren Satellitenschüsseln mehr Fernsehprogramme empfangen als sonst irgendwo auf der Welt.
Im Sommer kommen hierher Touristen aus Europa; dann gibt es etwas zu tun für Leute wie den einsamen Zugezogenen, der hier als Hoteldiener Dienst tut. Aber vorher und nachher herrscht Stille, in der man seinen Erinnerungen nachhängen und sie, wie dieser Johann Grahn es tut, in kleine Wachstuchhefte schreiben kann: Bilder einer fernen Kindheit in Deutschland oder einer noch sehr nahen Liebesgeschichte auf Island, Notizen über Leute und Landschaft, fragmentarische Reflexionen über die Zeit. Die freilich steht hier meistens so still, daß es keine Rolle mehr spielt, an welchem Datum die Zeitung erschienen ist, in der man zuweilen liest. Irgendwann ist aus den Notizen ein Buch geworden, in dem sich aus Vorzeit und Gegenwart allmählich ein Bild kristallisiert, das Züge von Liebe, Eifersucht und Tod erahnen läßt, mehr nicht. Im arktischen Zwielicht zeigt sich noch das tödliche Unglück sonderbar überscharf und folgenlos; die Geschichten gehen dahin, wohin in Ammassalik alles geht: ins Leere.
Mit solchen Notizen andere Leser als sich selbst auf die Dauer zu fesseln ist keine einfache Aufgabe. Erklärtermaßen fällt dem Erzähler, "seit ich hier lebe, oft über Stunden nichts ein, was ich jemandem erzählen könnte". Das müssen ziemlich genau die Stunden seiner Niederschrift sein, in der nämlich gut fünfzig Seiten später zu lesen ist: "Tatsächlich habe ich nicht viel mitzuteilen." Dem wird kein Leser widersprechen wollen. Aber nicht Mitteilung ist ja auch eigentlich Grahns Ziel, sondern die Suggestion des Stillstands, der fortschreitenden Kristallisation von Ich und Welt.
Wo das gelingt, da zeigt sich die Stärke dieses Schreibers. Weniger an Ransmayers "Schrecken des Eises und der Finsternis" oder Høegs Grönland-Roman nämlich lassen die Aufzeichnungen Grahns denken als vielmehr an Adalbert Stifters "Studien" und "Bergkristall", auf die sich schon der Titel beziehen läßt. Der Stillstand der Zeit, ihr ruhig-schönes und lebloses Erstarren, die kühlen Epiphanien der Dingwelt und die Stille über der Katastrophe: in der einverstandenen Darstellung solcher Zustände, in der spröden Sprache angesichts des Ungeheuren, in der scheinbar unbewegten Distanz des Betrachters gelingen zuweilen Panoramen einer Kristallwelt, die mehr zur Anschauung bringt als nur die Monumentalität einer Landschaft.
Hätte sich Klaus Böldl mit diesen eindringlichen Passagen begnügt, seine Erzählung wäre ein kurzes, strenges Prosastück geworden. Weil er aber eine philosophische und überdies poetisch selbstreflexive Parabel über Subjekt und Gedächtnis, Sein und Zeit schreiben wollte, zerbröseln ihm seine Kristalle oft unter den Händen. Kein Bild, das nicht früher oder später allegorisch ausgelegt würde, die titelgebende Kristallbildung gleich in leitmotivischer Wiederholung. Die Starrheit des Eises, seine unmerklichen Bewegungen, die plötzlichen Risse und die Bruchstücke, die kein Ganzes mehr ergeben - so nuanciert diese Anblicke geschildert werden, so monoton geraten sie zur poetologischen Allegorie. Ebensowenig paßt zur immer wieder proklamierten reinen Anschauung die dröge Abstraktion, dank deren "eine Welt von Überdeutlichkeiten", "Abwesenheit" als "Unvollständigkeit" und "eine einzige Fassungslosigkeit" im Text herumgeistern. Auf solchen Stelzen ist schlecht eislaufen.
Zumal die Erfahrung, wie das Empfinden von "Identität" (leider fällt auch dieser Begriff) in Schneelicht und Zeitferne erlischt, paßt nicht nur ins Landschaftsbild, sondern allzu glatt auch in jene akademische Theorie, die der Schreiber aus der deutschen Universität bis nach Grönland gerettet hat. "Damals, als ich mir noch eine Geschichte zuschrieb, die, einmal aufgedeckt, mich erzählen . . . würde" - in diesem Rückblick auf jugendliche Einfalt wird der Text zum Ort der Einschrift von, beispielsweise, Roland Barthes. "Ich kann nicht mich schreiben", hieß der Satz in dessen Formulierung: "Was wäre das für ein Ich, das sich schriebe?" In Böldls Erzählung zumindest ist es zunehmend ein gleichgültiges. Mag ja sein, daß der Schreibende etwas zu verheimlichen und deshalb allen Grund hat, mit seinen früheren Ichs nichts gemein haben zu wollen - alle einschlägigen Mystifikationen und Andeutungen aber bieten der Leserphantasie keineswegs Kristallisationskerne; wie das Schmelzwasser vom Gletscher verlaufen sie bloß im grönländischen Sand.
Dabei will doch der gebildete Erzähler gerade von der Bildung wegkommen, will nicht mehr deuten, nur noch betrachten. Sein Wunschtraum und Ziel ist ein Erzählen, das lediglich zeigen, aber nichts mehr bedeuten würde. Ihm soll es genügen, "daß sich kleine Geschichten ereignen, die nichts anderes bedeuten als sich selbst" - ganz ähnlich kann man es auch in Halldor Laxness' Erzählungen aus jenem Island lesen, das hier einen Nebenschauplatz abgibt; aber dort ergeben sich die Sentenzen auch wirklich aus einer Geschichte.
Bedenklicher noch als das philosophische Räsonnement ist die Geschwindigkeit, mit der ein phantastischer Einfall ins matte Klischee abrutschen kann. Man denke sich das Bild Europas unter einem glasklaren ewigen Eis, erstarrt im dornröschenhaften Schlaf - welche Anblicke würden sich wohl dem Beobachter bieten, der von hoch oben in diese zeitlose Wunderwelt hinabschaute? Hier kann sich die Leserphantasie tatsächlich alles Erdenkliche vorstellen, zuallerletzt aber die Bilder aus dem Reisebüro, die Böldl ihr bietet: "Das Auffliegen der Tauben auf dem Markusplatz in Venedig wäre konserviert, Flanierende auf den Champs-Elysées, dem Kurfürstendamm" - nein, da halten wir uns lieber an die Bilder von den Müllhalden in Kulusuk, deren zeitlose Schönheit dieser Text uns sehen gelehrt hat, am fernsten Ende der Welt. HEINRICH DETERING
Klaus Böldl: "Studie in Kristallbildung". Roman. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1997. 156 S., br., 18,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main