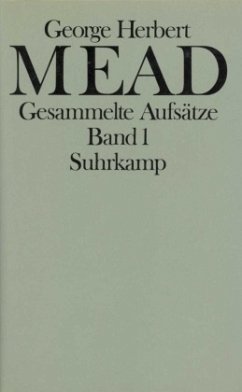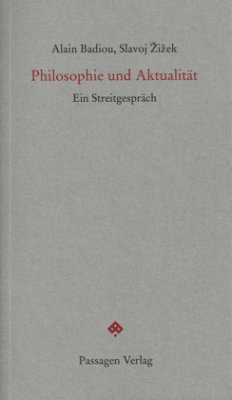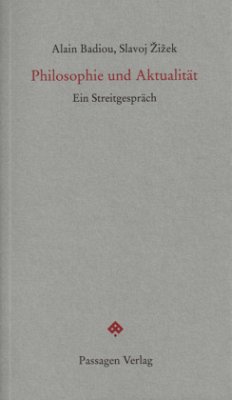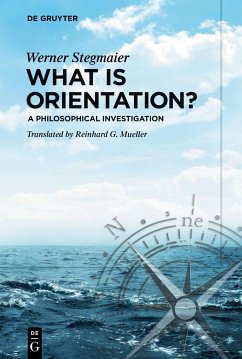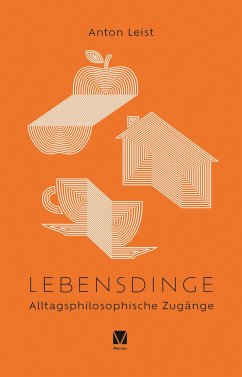Suchen und Finden
Lebensweltliche Formen
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
23,99 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
12 °P sammeln!
Die präzise und unvoreingenommene Untersuchung der Lebenswelt war und ist einer der zentralen Bereiche der Philosophie. Manfred Sommer unternimmt in seinen Arbeiten eine immer wieder überraschende und höchst originelle Deutung dessen, was unseren Alltag ausmacht. Suchen und Finden sind entscheidende Formen unserer Orientierung und unserer Selbstvergewisserung, die eine Vielfalt spannender philosophischer Aspekte eröffnen.Wir suchen zum einen nach Dingen und nach Zeichen, die auf sie verweisen; zum anderen nach Stellen und nach Wegen, die zu ihnen führen. Dabei helfen uns Geräte, Pläne u...
Die präzise und unvoreingenommene Untersuchung der Lebenswelt war und ist einer der zentralen Bereiche der Philosophie. Manfred Sommer unternimmt in seinen Arbeiten eine immer wieder überraschende und höchst originelle Deutung dessen, was unseren Alltag ausmacht. Suchen und Finden sind entscheidende Formen unserer Orientierung und unserer Selbstvergewisserung, die eine Vielfalt spannender philosophischer Aspekte eröffnen.
Wir suchen zum einen nach Dingen und nach Zeichen, die auf sie verweisen; zum anderen nach Stellen und nach Wegen, die zu ihnen führen. Dabei helfen uns Geräte, Pläne und Navigationssysteme. Suchen müssen wir, weil das, was wir sehen, uns anderes verdeckt. Was also steckt in, was hinter den Dingen? Was liegt jenseits des Horizonts? Was birgt die Erde in sich? Ein zu enges Gesichtsfeld und eine sprunghafte Aufmerksamkeit zwingen uns zu Methode und Kooperation. Zum Glück fehlt uns dann nur noch der Zufall.
Suchen müssen wir auch, weil wir nicht überall schon sind, sondern oft zu Orten erst hinwollen. In unserer vertrauten Lebenswelt kennen wir uns zwar aus, außerhalb jedoch müssen wir Selbstlokalisierung und Orientierung eigens zustande bringen. Dazu sichern wir uns aus der Vogelperspektive eine übersicht, die wir durch Kartographie objektiv darstellen.
Dann gehen wir aufs Ganze: Die Welt mit einem geographischen Koordinatensystem zu überziehen, macht jeden Ort genau benennbar; sie mit dem Satellitensystem GPS zu umgeben, heißt: Jeder kann jederzeit wissen, wo er ist und wohin er sich bewegt. Es ist, als ob die Welt unsere Lebenswelt wäre. Und der Routenführer nimmt dem Autofahrer die Wegsuche ab.
Wir suchen zum einen nach Dingen und nach Zeichen, die auf sie verweisen; zum anderen nach Stellen und nach Wegen, die zu ihnen führen. Dabei helfen uns Geräte, Pläne und Navigationssysteme. Suchen müssen wir, weil das, was wir sehen, uns anderes verdeckt. Was also steckt in, was hinter den Dingen? Was liegt jenseits des Horizonts? Was birgt die Erde in sich? Ein zu enges Gesichtsfeld und eine sprunghafte Aufmerksamkeit zwingen uns zu Methode und Kooperation. Zum Glück fehlt uns dann nur noch der Zufall.
Suchen müssen wir auch, weil wir nicht überall schon sind, sondern oft zu Orten erst hinwollen. In unserer vertrauten Lebenswelt kennen wir uns zwar aus, außerhalb jedoch müssen wir Selbstlokalisierung und Orientierung eigens zustande bringen. Dazu sichern wir uns aus der Vogelperspektive eine übersicht, die wir durch Kartographie objektiv darstellen.
Dann gehen wir aufs Ganze: Die Welt mit einem geographischen Koordinatensystem zu überziehen, macht jeden Ort genau benennbar; sie mit dem Satellitensystem GPS zu umgeben, heißt: Jeder kann jederzeit wissen, wo er ist und wohin er sich bewegt. Es ist, als ob die Welt unsere Lebenswelt wäre. Und der Routenführer nimmt dem Autofahrer die Wegsuche ab.