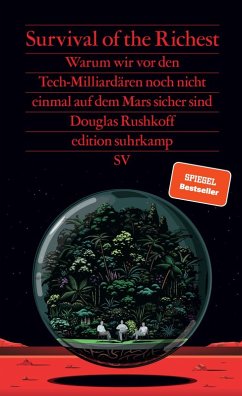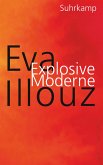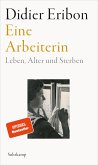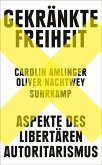Spätestens seit der Allianz von Donald Trump und Elon Musk ist klar: Die Tech-Milliardäre sind nicht nur die reichsten Männer der Welt, es geht ihnen auch um politische Macht und um die radikale Umgestaltung von Gesellschaft und Natur.
Als Douglas Rushkoff eine Einladung in ein exklusives Wüstenresort erhält, nimmt er an, dass er dort über Zukunftstechnologien sprechen soll. Stattdessen sieht er sich Milliardären gegenüber, die ihn zu Luxusbunkern und Marskolonien befragen. Während die Welt mit der Klimakatastrophe und sozialen Krisen ringt, zerbrechen sich diese Männer den Kopf, wie sie im Fall eines Systemkollapses ihre Privatarmeen in Schach halten können.
Der Medientheoretiker Rushkoff verfolgt die Internetrevolution seit Jahrzehnten, ist Erfinder der Begriffe »viral gehen« und »Digital Natives«, bewegte sich lange im Kreis von Vordenkern und kreativen Zerstörern. In einer Zeit, in der Elon Musk und Peter Thiel sich immer stärker in die Politik einmischen, rekonstruiert er, wie aus der Aufbruchsstimmung der 1990er ein Programm aus Angst und Größenwahn werden konnte. Viele Tech-Unternehmer wollen uns Normalsterbliche einfach nur hinter sich lassen, werden aber als Visionäre gefeiert. Angesichts der Zerrüttungen, die ihre Geschäftsmodelle produzieren, müssen wir uns von ihrem Mindset befreien - denn mitnehmen werden sie uns auf ihrem Exodus sicher nicht.
Ein flammendes Plädoyer gegen Egomanie und für die Wiederentdeckung kooperativen Handelns
Als Douglas Rushkoff eine Einladung in ein exklusives Wüstenresort erhält, nimmt er an, dass er dort über Zukunftstechnologien sprechen soll. Stattdessen sieht er sich Milliardären gegenüber, die ihn zu Luxusbunkern und Marskolonien befragen. Während die Welt mit der Klimakatastrophe und sozialen Krisen ringt, zerbrechen sich diese Männer den Kopf, wie sie im Fall eines Systemkollapses ihre Privatarmeen in Schach halten können.
Der Medientheoretiker Rushkoff verfolgt die Internetrevolution seit Jahrzehnten, ist Erfinder der Begriffe »viral gehen« und »Digital Natives«, bewegte sich lange im Kreis von Vordenkern und kreativen Zerstörern. In einer Zeit, in der Elon Musk und Peter Thiel sich immer stärker in die Politik einmischen, rekonstruiert er, wie aus der Aufbruchsstimmung der 1990er ein Programm aus Angst und Größenwahn werden konnte. Viele Tech-Unternehmer wollen uns Normalsterbliche einfach nur hinter sich lassen, werden aber als Visionäre gefeiert. Angesichts der Zerrüttungen, die ihre Geschäftsmodelle produzieren, müssen wir uns von ihrem Mindset befreien - denn mitnehmen werden sie uns auf ihrem Exodus sicher nicht.
Ein flammendes Plädoyer gegen Egomanie und für die Wiederentdeckung kooperativen Handelns
Rezensent Harald Staun nickt vieles ab, was Douglas Rushkoff in seinem Buch über Tech-Oligarchen schreibt, aber der übergeordnete Erkenntnisgewinn scheint sich für ihn in Grenzen zu halten. Dass superreiche Tech-Unternehmer wie Elon Musk, Jeff Bezos oder Peter Thiel immer mehr auch politische Macht bekommen und dabei der Illusion verfallen sind, dass man vor dem Weltuntergang immer noch irgendwohin, und sei es ins All, flüchten könne, ist für Staun so erschreckend wie an der Tagesordnung. Lesenswert scheint er zu finden, wie der amerikanische Medientheoretiker dies als eine Flucht auf die je neue Meta-Ebene analysiert, die kein Zurück kennt. Von Vorteil sei für den Autor die eigene Vergangenheit als Mitglied einer Cyberpunk-Bewegung und auch die persönliche Begegnung mit einigen solcher Tech-Oligarchen, die Rushkoff in seine Überlegungen zum "Mindset" dieser Menschen einfließen lässt - dass er dieses Asperger-ähnliche Mindset sowohl als Symptom als auch als Ursache eines "westlichen, linearen Fortschrittstrebens" sieht, wie Staun den Autor zitiert, sei dann auch die "Pointe" Rushkoffs. Das scheint für den Kritiker in sich schlüssig dargelegt zu sein, aber wie sinnvoll er Rushkoffs Thesen, etwas sein Plädoyer für die Kybernetik als eine Art Rückkehr zur Natur, letztlich findet, wird nicht ganz deutlich.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Interessiert, aber nicht ohne Skepsis liest Rezensent Thomas Ribi Douglas Rushkoffs Buch über das Selbstverständnis der Superreichen. Seinen Ursprung hatte das Buch bei einem Treffen mit fünf Multimilliardären, die vom Autor wissen wollten, wie sie kommenden Katastrophen, etwa dem Klimawandel oder sozialen Unruhen entkommen könnten, erfährt der Kritiker von Rushkoff. Paradox dabei erscheint, dass jene Reiche zwar glauben, dass Technik die meisten Probleme lösen kann, aber gleichzeitig unterirdische Bunkeranlagen planten, um der Welt und ihren Problemen zu entkommen, resümiert Ribi. Was aber, hat Rushkoff, seines Zeichens Marxist, selbst als Lösung anzubieten? Nicht allzu viel, seufzt Ribi, der Stichworte wie "Kreislaufwirtschaft" gern näher erklärt bekommen hätte. Zudem scheint Rushkoff, der aus der Cyberpunk-Tradition kommt, nicht zu bemerken, wie nah seine eigene einstige Techbegeisterung dem "Mindset", das er kritisiert, tatsächlich ist.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH