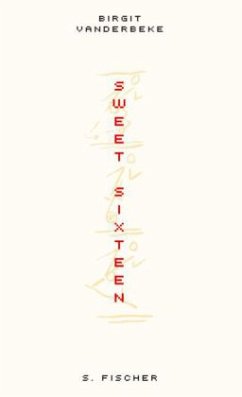Birgit Vanderbeke, geboren 1956 in Dahme/Mark, lebt im Süden Frankreichs. Sie wurde 1990 für die Erzählung "Das Muschelessen" mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. 1997 erhielt sie den Kranichsteiner Literaturpreis und 1999 den Solothurner Literaturpreis für ihr erzählerisches Gesamtwerk, 2002 wurde ihr der Hans-Fallada-Preis verliehen. Zuletzt erschienen "Geld oder Leben" und "Schmeckt's? Kochen ohne Tabu".
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Es gibt ja, konstatiert Ijoma Mangold, unter den deutschen Schriftstellern so eine "neue Faszination für den Straßenkampf und den Aktionismus", nicht selten verbunden mit einem verklärenden Blick auf eine Zeit, in der die Herzen vermeintlich wild waren und junge Menschen ihre Ideale an den Himmel sprühen wollten. Auch Birgit Vanderbeke, vermutet Mangold, pflegt solche Sehnsüchte und hat sich deshalb eine Verschwörung 16-Jähriger ausgedacht, die die Nase voll haben von Konsum und Fernsehverblödung und Botschaften aus dem Untergrund schicken. Doch wo ist das Abenteuer? Wofür brennen die Herzen? Und wer sind diese Kids überhaupt? Vanderbeke, urteilt Mangold, weiß von ihnen "nicht mehr als deren Eltern". Dafür hat sie keinen Aufwand gescheut, um die Revolte, die keine ist, sondern nur Gelaber, korrekt zeitgemäß mit modernster Kommunikationstechnologie auszustatten, mit dem Ergebnis, dass der Rezensent dort, wo die Erzählung sein sollte, hauptsächlich "superpenetrante Computervokabularsoße" vorfindet. Fazit: Eine "unerträgliche Ranschmeiße" und ein dazu Werk von "niederschmetternder Bravheit".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Birgit Vanderbeke möchte Teil einer Jugendbewegung sein
Birgit Vanderbeke hat eine Hommage an alle Sechzehnjährigen verfaßt, die schon in einem Alter über Info-Highways rasten, als ihre Eltern noch vom Dreirad fielen. Kaum dem Schnuller entwöhnt, waren dieser Generation die einschlägigen Links zum Extremsex vertraut, den elektronischen Hausaufgabenservice hatten sie vor dem Abc abgespeichert und den Eltern dabei leicht gereizt erklärt, daß sie zum "Googeln" nicht ihr Planschbecken brauchten. Auf dem Kinderzimmer-PC konnten sie vom heimischen Bombenbasteln über kabbalistische Geheimlehren bis zur mongolischen Stutenmilchgärung jedes erdenkliche Detail erfahren, und all das ohne die geringste Aufsicht. Denn zur Installation von Schutzprogrammen fehlten seitens der Erzieher Problembewußtsein und Know-how.
Ein fröhliches Nebeneinander von Fatalismus, Schwundstufenpädagogik und Weltuntergangsgerede schweißt Eltern, Ordnungskräfte und mediale Plaudertaschen zu einer ratlosen Öffentlichkeit zusammen, als in "Sweet Sixteen" immer mehr Jugendliche an ihrem sechzehnten Geburtstag spurlos verschwinden. In einem Netz-Manifest geben sie bekannt, daß sie sich "das Wesentliche künftig selber" beibringen würden, statt sich weiter mit "Depressos" und "Regressos" herumzuschlagen. Vanderbekes Aussteiger sind ein Hybrid aus Berliner Spontis, französischen Fassadenskatern, japanischen Suizid-Chatvereinen, globalen Bloggern und No-Logo-Partisanen. Wie die Achtundsechziger treffen sie auf eine völlig unvorbereitete Öffentlichkeit, die nicht länger mit dem Wirtschaftswunder, sondern mit auseinanderfallenden Familien- und Sozialstrukturen, Wellnessurlauben und der eigenen Nabelschau beschäftigt ist.
Das Besondere am "Sweet Sixteen"-Enigma, konstatiert ein Leitartikel, sei "gerade nicht die Flucht aus der Wirklichkeit, sondern die Flucht in die Wirklichkeit". Birgit Vanderbekes burleske Erzählung macht sich diese These zu eigen. Ökonomisch knapp und trocken komisch führt sie die mentalen Schrebergärten vor, aus denen die Kids in die Jetztzeit entkommen. Worthülsen und sprachliche Multiples der Betroffenheitsgesellschaft passieren Revue, wenn eine Fernsehmoderatorin familiäre Abendessen als Rituale bezeichnet und nach dem Verschwinden ihres Sohnes medienwirksam von einer "schlimmen Zeit der Ungewißheit" spricht. Ein Polizist legt den Maßstab der eigenen Jugend an und erwidert einer besorgten Mutter: "Was wird sein, er wird Party machen. In dem Alter machen sie alle Party." Doch Birgit Vanderbeke weiß, daß die Kinder des Mauerfalls nicht länger in Partykellern zusammenhocken, sondern einzeln ausschwärmen, im Kopf vernetzt. Ob sie in der Berliner Hausbesetzerszene unterschlüpfen, wie der Text suggeriert, sei dahingestellt. Wahrscheinlich sind die Kids längst in Hongkong, Taipeh oder Katmandu.
Wo immer sie stecken mögen, die als Trendforscherin tätige Erzählerin hat den Ehrgeiz, ihnen auf die Schliche zu kommen. Sie durchforstet das Netz nach mysteriösen Foren und lauscht den launigen Konversationsschnipseln des fünfzehnjährigen Josha wie Ödipus der Pythia. Was die Hypothesen betrifft, die sie mit ihren Kollegen durchgeht, ist die Handlung wie ein Krimi angelegt. Doch im Laufe des Buches stellt sich heraus, daß es in ihm weniger um die fremde Welt heutiger Adoleszenten als um vertraute Rückblicke in die Pubertät der Erzählerin geht. Die urbanen "Parkour"-Kletterer vergleicht sie mit den Trümmerfeldeskapaden der Nachkriegskinder, Demos und Kommunen mit Schülern, die in Kaufhäusern und Internetcafés den Unterricht schwänzen, Joshas Kultfilm "Fight Club" mit dem Abenteuerbuch "Fünf Freunde", dem Märchen vom Hamelner Rattenfänger und dem "Letzten Tango in Paris".
Daß eine Protestgeneration hier bei der nächsten Anschluß sucht, wird ganz deutlich, als Kurt Kutsch, ein an Wolf Biermann angelehntes Faktotum der politischen Klampfenrhetorik, zum heimlichen Sympathisanten der "Sweet Sixteen"-Bewegung aufsteigt. Seinem Kommentar schaltet die Autorin sogar die letzte Seite frei: "Nun, vielleicht entsteht da etwas Neues. Etwas Wildes. Etwas Aufregendes", frohlockt er als Apo-Opa in Zeiten des entgrenzten Wellnessbereichs.
Sein Auftritt ist nicht ganz weit hergeholt. Vanderbekes Erzählung trifft genau die ins Moralische kippende Abtauchstimmung vieler Kids, die aus den Konsum-Ekstasen der Jahrtausendwende mit seelischen Bulimiesymptomen erwachen. Doch die Versuchung, in ihrem Aufbegehren das der Sit-ins und Friedensmärsche wiederzuerkennen, verleitet zur Musealisierung eines noch offenen Phänomens und nimmt dem Stoff einen Teil seiner Schubkraft. Das Rätsel, das eine Altersformation der anderen ist, steht nach dem abrupten Erzählschluß ungelöst im Raum. Die Erzählerin findet ein kühnes Bild dafür. Sie erinnert sich an Surfer in schwarzen Latexanzügen, die ihr vom Strand aus wie Pinguine vorkamen: "Plötzlich richteten sie sich auf, nicht alle auf einmal, aber alle. Sie drehten sich kurz um, sahen aufs offene Meer, und jetzt kam die Welle."
Birgit Vanderbeke verpaßt die nächste Welle, indem sie die schwerelos dahingleitende Erzählung überstürzt in einer Farce enden läßt: Kutsch gerät als gefährlicher "Schläfer" auf den Radarschirm des Verfassungsschutzes, ein mißglückter Aufruf an die Jugend löst gar eine Regierungskrise aus. "Sweet Sixteen" hätte weniger von der paternalistischen Ironie der Erzählerin und mehr vom absurden Witz der Schnittstellen gebrauchen können, an denen Birgit Vanderbeke die High- und Low-Tech-Generationen aufeinandertreffen läßt. "Mann, bist du schnell", bemerkt ihr weiblicher Trendscout, als Josha eine SMS eintippt. "Anders geht's nicht, sagte er. Entweder du bist schnell, oder du bist draußen." Die beim Texten gültige Maxime läßt sich bei Texten nur bedingt anwenden. Durch sie wurde ein streckenweise sehr witziges Buch um seine wahre Dimension gebracht. Die Erzählerin hätte weniger auf die medialen Displays und dafür länger aufs Meer schauen sollen.
INGEBORG HARMS.
Birgit Vanderbeke: "Sweet Sixteen". S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2005. 140 S., geb., 16,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main