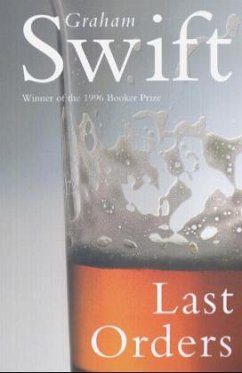An einem Morgen im Frühling treffen sich vier Freunde in ihrer Londoner Stammkneipe: der Versicherungsagent Ray, der ehemalige Boxer Lenny, jetzt Gemüsehändler, Vic, der Leichenbestatter, und Vince, der Gebrauchtwagenhändler. Vom Pub aus fahren sie ans Meer, um dort die Asche ihres soeben verstorbenen Kumpels Jack zu verstreuen. Ihre tragikomische Pilgerfahrt, von Kneipenbesuchen unterbrochen, führt sie nicht nur durch die Landschaft Kents, sondern auch ein halbes Jahrhundert zurück in die Vergangenheit. In den Monologen der Männer kommt all das zur Sprache, was ihr Leben ausgemacht und bewegt hat: die stillen Dramen, die verpaßten Gelegenheiten, Schuldigwerden, Unrecht, das sie sich auch gegenseitig zugefügt haben.

Graham Swifts "Letzte Runde" / Von Eberhard Rathgeb
Kurz bevor er stirbt, hört er Radio. Er liegt seit einigen Wochen im Krankenhaus, ein hoffnungsloser Fall. Der Magenkrebs frißt an seinem alten Körper, und die Ärzte haben den Gedanken an eine Operation verworfen. Heilung ist ausgeschlossen. Er heißt Jack, und von seinem Bett aus, das er nicht mehr verlassen wird, trifft er die letzten Vorkehrungen. Er hat Schulden, von denen seine Frau nichts weiß, und was er also jetzt, am Ende seines Lebens, dringend braucht, das ist ein bißchen Glück und ein Batzen Geld. Also bittet er seinen Freund Ray, er möge alles, was er noch habe, auf eine Karte setzen. Das ist nicht viel, es sind eintausend Pfund, die er sich geliehen hat.
Jack hat Glück und stirbt. Er hinterläßt ein Testament; er bittet alle, die es angeht, seine Asche in Margate ins Meer zu streuen. Also nehmen seine vier Freunde die Dose mit Jack und raffen sich auf, fahren von Bermondsey nach Margate, um dort die Überreste ihres Freundes dem Wasser zu übergeben. Sie fahren in einem blauen Mercedes, machen einen Abstecher zu einem Kriegerdenkmal und besuchen die Kathedrale in Canterbury. Sie trinken unterwegs Bier, vertragen und schlagen sich. Als sie ankommen, das Meer vor, das Leben hinter sich, regnet und stürmt es. Sie kämpfen sich auf dem Pier nach vorne, greifen in die Urne und halten in den Wind, was von Jack neben den Erinnerungen übriggeblieben ist, ein paar Handvoll Asche. Da gehen sie hin, achtundsechzig Lebensjahre.
Vier Männer nehmen Abschied. Einer heißt Ray; er war mit Jack in der Wüste, und gemeinsam haben sie dort gegen Rommel gekämpft. Ray hat als Angestellter für eine Versicherung gearbeitet, und er hatte Glück beim Wetten. Einer heißt Lenny, auch ein Wüstenkämpfer; er boxte für Geld und übernahm später ein kleines Obst- und Gemüsegeschäft. Einer heißt Vic, war bei der Marine, scheut Tote nicht und ist Leichenbestatter geworden. Der letzte im Bund heißt Vince, deutlich jünger als die drei alten Knacker; er betreibt einen Autohandel, ein ehemaliger Fremdenlegionär und Jacks Adoptivsohn.
Graham Swift hat seine Figuren im Jedermannstal gesucht und gefunden. Niemand würde erwarten, daß es über sie viel zu erzählen gäbe. Es sind alles mehr oder weniger unscheinbare Existenzen, und sie taugen nicht dazu, für mehr als für sich allein zu stehen. Jack ist Jack, keine Geschichte wird ihn aus seiner Haut herausholen. Die Individualität ist eine Alltagserscheinung, ihre Oberfläche banal und ihre Form reduziert. Was diese Menschen zu sagen haben und was über sie zu sagen wäre, läßt sich auf biographischen Anmerkungen in Postkartengröße unterbringen. Wie in ein Erinnerungsalbum fügt Swift diese Schnipsel von Existenzen zu einem Roman zusammen, dessen kleine Andeutungen sich erst erschließen, wenn man ihre Leben durchlaufen hat und ebenfalls zurückblicken kann. Graham Swift hat keinen Roman über kleine Leute geschrieben, sondern ein Buch ohne große Worte.
Ray hat mit Jacks Frau Amy ein Verhältnis gehabt, und Vic weiß davon. Vince schwängerte in jungen Jahren Lennys Tochter Sally, und Lenny zwang seine Tochter zur Abtreibung. Sally landete auf dem Strich. Vince traf dann Mandy, sie bekamen eine Tochter, die hieß Kathy und landete auch auf dem Strich. Jack und Amy hatten eine Tochter, die hieß June und landete in einem Heim für Geistesgestörte. Ray hatte eine Frau, die hieß Coral, und sie beide hatten eine Tochter, die hieß Sue, und Coral nahm nach langen trüben Ehejahren Reißaus, und Sue wanderte aus Bermondsey nach Australien aus.
Die Männer treffen sich regelmäßig in einer Kneipe, wo sie in Ruhe ein Bier trinken und schwatzen können. Die Alten haben nicht mehr viel zu melden, das Leben ist so gut wie vorbei, einiges ist schiefgelaufen, was sich nun nicht mehr geradebiegen läßt. Sie werden sich auf ihre alten Tage nicht mehr ändern, alles ist immer schon Routine gewesen. Sie stehen im Abseits und trinken ihr Bier. Jack, der Metzger, hatte Arzt, Ray, der Büroangestellte, hatte Jockey werden wollen; Lenny, das arme schlagkräftige Würstchen, hatte sich ein größeres Stück vom Kuchen erhofft; und Vic, der Leichenbestatter, schaut seit eh und je von der anderen Seite, wo die irdischen Hoffnungen erloschen sind, herüber. Die Kneipe heißt "Coach", und es sieht so aus, als sei sie in Bermondsey steckengeblieben, so wie die vier Männer am Tresen, die von der Welt nichts gesehen haben, wenn man vom Krieg absieht, und nichts mehr von der Welt sehen werden.
Der kleine Trauerzug nach Margate reist gegen die Zeit. Die Fahrenden erwartet der Tod; wenn sie sich umdrehen, sehen sie Flickwerk, und das ist ihr Leben. Weit und breit sind keine Helden zu sehen, es gibt nur Nebenrollen auf abgelegenen Nebenschauplätzen. Keiner hatte hier mehr zu sagen als die anderen. Also ergreift mal der eine, mal der andere das Wort. Leben in Bermondsey bedeutet, darüber nicht viele Worte zu machen. Im Gegenteil, was sich erzählen ließe, soll lieber verschwiegen werden. Deswegen holt keiner der Reisenden zu einem langen Bekenntnis aus; deswegen erhebt keiner der Reisenden seine Stimme, um seinem Leben zu einem Recht zu verhelfen; deswegen hat keiner eine Geschichte parat, die sie über den Tellerrand ihrer Existenz blicken ließe. Sie sitzen alle im selben Auto, sie haben alle dasselbe Ziel, doch sie bleiben für sich, unverstanden, hoffnungsarm, traurig, schrullig, lauthals sprachlos.
Graham Swift erzählt vorderhand eine Geschichte, die es in ihren Grundzügen schon einmal gegeben hat. William Faulkner schilderte in seinem in den dreißiger Jahren erschienenen Roman "As I Lay Dying" den Leichenzug einer armen Familie, die den letzten Wunsch der Ehefrau und Mutter Addie Bundren erfüllen will und sich also aufmacht nach Jefferson, um die Tote dort, in ihrer Heimatstadt, zu beerdigen. Auch Faulkner läßt die Beteiligten selber zu Wort kommen, erzählt die Geschichte aus ständig wechselnden Perspektiven. Fünfzehn Stimmen erheben sich hier, und die Reise in einem von Pferden gezogenen Wagen erstreckt sich über mehrere Tage. Hinten im Wagen liegt der Sarg, und die Leiche stinkt schon gen Himmel, wo Bussarde kreisen. Faulkner beschreibt nicht, er sucht die Unmittelbarkeit, die Sprache, das Herz seiner Figuren. Sie alle sind Helden in ihrem Alleinsein, bewegt von ihren wenigen Hoffnungen und gehalten von ihrem flackernden Glauben an den lieben Gott, an eines Menschen Pflicht und an die gute Tat.
Graham Swift behielt den Perspektivenwechsel bei, doch er reduzierte die Anzahl der Stimmen, und er reduzierte die Sprache, weil seine Helden keine mehr sind und auch keine sein wollen, weil seine Figuren im Abseits ihr Leben führen. Sie bewegen sich am Gängelband des Einerlei, ziehen ihre engen Kreise und laufen in der Kneipe ein, wo sie unter sich und für eine Weile mit sich zufrieden sind; traurige Gestalten, die sich selbst verpaßt haben, die wurden, wie sie sind, gleichsam als wären sie nicht dabeigewesen. Sie sind auf das Maß ihrer Routine geschrumpft, die sie auffrißt und aus der nur die Flucht zu helfen scheint, die dann ihre Kinder, ihre Frauen antreten. Sie versuchen, sich in Erinnerungen, die sie durch Wiederholungen fixieren, einzurichten. Sie reden, doch sie finden die richtigen Worte nicht.
Hier springt Swift ihnen zur Seite, er leiht ihnen Sätze für die Dauer eines klugen Gedankens und einer ergreifenden Episode, er gibt ihnen, was ihnen fehlt, eine Sprache für ihr Schweigen, das sie, trotz aller Kneipengeselligkeit, in der Einsamkeit hält. Diese Hilfestellung dokumentiert nicht das Versagen eines Autors vor seinen Figuren. Im Gegenteil, sie zeigt, was noch zu erzählen sei und wie es noch erzählt werden könnte. Was wie die Reprise eines Klassikers aussehen mag, das ist die Vergewisserung literarischer Möglichkeiten. Die englische Kritik wies auf Chaucers "Canterbury Tales" als Vorbild für Swifts Roman hin. Damit ist aber nichts gewonnen, denn die Radikalisierung des ästhetischen Ausdrucks ist ein modernes Problem, an dem Swift nicht vorbeisehen konnte. Seine Antwort ist die Variation auf ein Thema, nicht mit dem Pathos der Ewigkeit, sondern mit ironischer, zuneigender Distanz.
Am Ende, wenn die vier Männer ihre Hände in die Dose stecken, eine Handvoll Asche herausholen und Jacks sterbliche Überreste in den Wind streuen, wenn sie einfach dastehen, schauen und schweigen, sind sie zum ersten Mal in der Ahnung miteinander verbunden, daß sie allen Erwartungen gerecht geworden sind, im Guten wie im Schlechten, und daß dies der Beginn einer anderen Geschichte sein könnte. Doch dafür ist es jetzt einfach zu spät. Man kann, so Swift, nicht einmal mehr für das Alleinsein der anderen die richtigen, die unmittelbaren Worte finden und seinen Figuren in den Mund legen, allerhöchstens ein letztes, ein Sterbenswörtchen darüber fallenlassen. Der große überwältigende Rest ist geteilte Einsamkeit und betretenes und beredtes Schweigen, das der Autor, einem Geheimnis gleich, ein wenig lüftet. Das kann man zeigen, indem man es erzählt, und Graham Swift ist dies in seinem wunderschönen und nachdenklichen Roman anspielungsreich und glänzend gelungen.
Graham Swift: "Letzte Runde". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Barbara Rojahn-Deyk. Hanser Verlag, München 1997. 326 S., geb., 39,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main