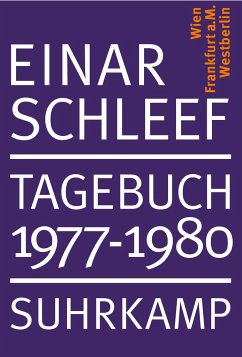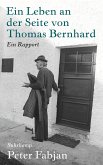"Daß Aufrichtigkeit in der Kunst und Authentizität im Leben sehr wohl möglich sind das zeigen Einar Schleefs Tagebücher der Ostberliner Jahre. Der Preis dafür lautet Ausgrenzung, Einsamkeit und permanentes Anecken. Und um das auszuhalten, muß man wahrscheinlich brennen können ... muß man wahrscheinlich so ein Klumpen ungewaschenen Goldes in einem Meer von Plastikexistenzen sein, wie Einar Schleef es gewesen ist", hieß es im WDR über Einar Schleef und Band 2 seines Tagebuchs (1964 1976).
1977 zieht Schleef von Wien der ersten Station im Westen nach Frankfurt am Main, am Ende des Jahres nach Westberlin. Er schreibt u.a. zahllose Briefe an seine
Freundin, die beim Versuch der Republikflucht geschnappt wurde. 1978 entwickelt er
Siegfried Unseld den Plan eines monumentalen Romans aus der Perspektive seiner Mutter
Gertrud. Die Arbeit beginnt unterstützt von der Freundin, die vorzeitig aus
der Haft entlassen worden ist. 1980 erscheint Gertrud, Band 1. Wilde Jahre sind auch diese erstenim Westen verbrachten, in denen Einar Schleef dem Tagebuch Beobachtungen, Verwirrungen und Orientierungsversuche politisch, gesellschaftlich und ganz persönlich dringend mitzuteilen hat.
1977 zieht Schleef von Wien der ersten Station im Westen nach Frankfurt am Main, am Ende des Jahres nach Westberlin. Er schreibt u.a. zahllose Briefe an seine
Freundin, die beim Versuch der Republikflucht geschnappt wurde. 1978 entwickelt er
Siegfried Unseld den Plan eines monumentalen Romans aus der Perspektive seiner Mutter
Gertrud. Die Arbeit beginnt unterstützt von der Freundin, die vorzeitig aus
der Haft entlassen worden ist. 1980 erscheint Gertrud, Band 1. Wilde Jahre sind auch diese erstenim Westen verbrachten, in denen Einar Schleef dem Tagebuch Beobachtungen, Verwirrungen und Orientierungsversuche politisch, gesellschaftlich und ganz persönlich dringend mitzuteilen hat.

Ich bin der Handlanger meiner Mutter: Das dritte Tagebuch von Einar Schleef / Von Günther Rühle
Einar Schleef, der besessene Theatermann, der 2001 im Alter von siebenundfünfzig Jahren starb, war auch als Tagebuchschreiber ein Berserker. Der dritte Band zeigt einen, der sich und andere verwunden musste.
Einar Schleefs Tagebücher sind nicht wie andere; sie entstanden aber aus dem gleichen Impuls: Leben festzuhalten, Tag für Tag, am liebsten jeden Moment. Schleefs Dokumentationen sind weit entfernt von Arthur Schnitzlers oder Thomas Manns kühler, sachlicher Lebensbuchhalterei. Seine Tagebücher sind Konglomerate von drängenden Wortströmen, von Gefühlen, Empfindungen, Sehnsüchten, Schmerzen, Klagen, sich ballenden Erinnerungen, von Erfahrungen, Entschlüssen, von Denken und Bedachtem, von Schlussmachen und Wieder-Anfangen, Ängsten und Befreiungen, von Körperbrunst, Liebesverlangen, Verwundungen, Beschimpfungen, von Seelennot, Leere, Einsamkeit und Lebensarmut. Dies alles: trotz und inmitten reichster Begabung. Schleef sammelt Berichte, Notizen, Briefe, Selbstgespräche, Dialoge, zart, brutal, sachlich, poetisch, wuchernd, komprimiert - ein Durcheinander, noch mal kompliziert mittels durcheinandergewürfelter Zeit, nach- und eingeschobener, vor- und rückblickender Kommentare aus dem Jahr, in dem es schon ans Sterben ging. "Materialkontrast" nannte er das. Alles zusammen: eine Gärung! Die Sammlung wird nun dem Leser nachgereicht, der begriff, wer Schleef war, oder der begreifen soll, wie leidvoll erkauft war, was er wurde. Einar Schleef war kein ordentlicher Bürger, er war ein außerordentlicher Arbeiter in vielen Künsten.
Man liest sich, staunend, verzweifelnd, schockiert, sich immer wieder aufraffend, gefesselt und am Ende befreit, durch den dritten Band dieser großen, wuchernden Emanation eines Lebens, das sich dem eigenen Chaos entziehen musste, um sich zu finden. Dieses Leben brach 2001, auf dem Gipfel. Der weitgreifende und doch enge, immer wieder auf das Ich konzentrierte Daseinsbericht geht nur über vier Jahre. Er beginnt mit den Tagen in Wien, Anfang 1977, als der lebensverändernde Entschluss vollzogen war, trotz der Rückrufe in die DDR nicht zurückzugehen in die engen Verhältnisse, unter deren ideologischer Last er herangewachsen war. Er endet 1980, als man diesen Schleef schon anders, erstaunender wahrzunehmen begann als zuvor.
Bis dahin war Einar Schleef der Regisseur, der im Berliner Ensemble mit dem Freund B. K. Tragelehn 1975 das skandalmachende "Fräulein Julie" inszeniert hatte, das ihm bald, wie sein folgendes Kinderstück, verboten wurde. Die spürbare schikanierende Bedrängnis war nur ein Grund für die Flucht; er sagt ausdrücklich, er konnte dort, in Ost-Berlin, nicht mehr leben. Er brauchte Freiheit, wahrscheinlich auch das Sichzurechtfinden in der eigenen Wirrnis. Sein Denken sei aus den Fugen wie seine Sexualität, notiert er einmal. Die Texte geben manche Bestätigung. Daheim in Sangerhausen, im Berliner Ensemble wurde er als Republikflüchtling beschimpft. Gabi, seine Freundin, die einzige Frau, die ihm je wirklich nahe kam, suchte ihm über die Grenze zu folgen, wurde im März 1977 drüben verhaftet; zwei Jahre kam sie ins Gefängnis. Die kontrollierten und die nicht ausgelieferten Briefe an sie finden sich hier.
Gleich brach der Vertrag mit dem Burgtheater, der ihn herübergebracht hatte. Von Wien trieb es ihn nach Stuttgart, nach Frankfurt, nach West-Berlin, wieder nach Frankfurt (Heimatstadt seines Vaters, der ihn viel schlug), dann Düsseldorf, Frankfurt, schließlich wieder Berlin, oft in düsteren Verhältnissen, Wohngemeinschaften. Lichtungen, wie die mit Günter Beelitz für zwei Jahre beschlossene Theaterarbeit in Düsseldorf, verlässt er, mut-, freiwillig? In Wien war es "Schloß Wetterstein" von Wedekind, hier der "Todestanz" von Strindberg, was auf der Strecke bleibt. "Es kotzt mich an. Ich kann hier nicht bleiben", notiert er in Düsseldorf. In Frankfurt: "Nichts ist schrecklicher, als im Theater anfangen" , als er im TAT ein Gefängnistheaterprojekt übernimmt. Auch das scheitert, als wäre er noch immer auf der Flucht. Zweifel, ob er nicht doch zurückgehen soll, werden weggesteckt. Er fürchtet Gefängnisse aller Art, weil er sich selbst als Gefängnis empfindet. Und ist doch, durch all das Chaos, auf einer Spur zu sich selbst.
Stück für Stück kommt sie in diesem Konglomerat von Texten zum Vorschein. In Peter Handkes Buch "Wunschloses Unglück" findet er Literatur, die ihn trifft, in Hans Neuenfels' Inszenierung der "Medea" in Frankfurt das Bühnenerlebnis, das ihn weitertreibt. Lebensverändernd aber wirkt ein emotional hingeworfener, antreibender Satz in einem jener gutwilligen Gespräche in Wien, wie man dem Flüchtling Schleef helfen könne. Die Szene ist wie eine Ouvertüre zum Tagebuch. Schleef bei Hilde Spiel. Zwei unvereinbare Naturen begegnen sich. Die Situation wurde nervig. Aus "Widerstand gegen die Spiel" erzählt Schleef von seiner Mutter, von Gertrud, die er liebt, die er hasst, die er unsichtbar mit sich herumschleppt. Da geschieht's: "Doch mittendrin unterbricht sie mich, sie schreit, schlägt mit der Hand auf den Tisch: Dann schreiben Sie es auf! Schreiben Sie es auf! Mehr kommt nicht, es folgt kein weiterer Satz, doch der Hieb hat gesessen, ich zucke zusammen, versuche mich zu beruhigen, sie hat recht, was nützt mein Gejammer. Ich beginne zu schreiben."Das wurde der Anfang von "Gertrud".
Das Tagebuch erzählt immer wieder von ihr ("Ich bin der Handlanger meiner Mutter"). Es erstreckt sich über die Zeit der Niederschrift, aber Schleef gibt keine Auskunft über die Genese des Buches und des Autors mit ihm. Ahnungen nur nähren das Zusammendenken.
Elisabeth Borchers hat später ein Stück davon in den Verlag gebracht. Der Verlag wurde sein Haus. Schleef rühmt es nicht. Er hatte immer Schwierigkeiten mit der Dankbarkeit. Nur dem in der DDR verlassenen B. K. Tragelehn sagt er hier (fast verschämt) danke. Den Dank für die Zuwendung Golo Manns erspürt man nur an der Hereinnahme seiner Briefe. Im dauernden Kampf mit sich selbst und gegen alle anderen, selbst gegen die Freunde, verbarg sich seine Herzlichkeit. Schleef brauchte mehr Liebe, als er geben wollte und konnte.
Dabei zog er Männer wie Frauen an. Durch die Texte drängen sich lebensnahe Freunde: Wolfgang Storch, Clemens Eich, Florian Havemann, Rudolf Rach; dann die Begegnungen auf dem Weg: Rainer Werner Fassbinder, Andrea Breth und andere - Schleef nennt alle und alles beim Namen. Seine magnetische Kraft brachte keine dauerhaft-verlässliche Bindung, außer mit seinem Lektor, dem geduldigen Hans Ulrich Müller-Schwefe. "Ich bin keine Person, die nicht stört. Ich störe. Ich brauche die Fremdheit." Der Streitdialog mit der nach zwei Jahren endlich aus dem DDR-Gefängnis entlassenen Frau, an deren Schicksal er sich doch schuldig fühlt, der er immer wieder seine Liebe zuspricht, tut einem beim Lesen noch weh: "Wir beide sind wund. Jede Berührung tut weh. Die Rissstellen bluten. Ich will dich nicht wiedersehn!" Schleef war auf Schonung anderer nicht aus. Er schont auch sich selbst nicht. Erschrocken fragt er: "Was tue ich mit mir? Warum bin ich mein eigener Feind?" Wer das Tagebuch liest, sieht in den verborgenen, verquälten Schleef, der sich anstrengt, schreibend über die Risse in sich selbst hinwegzukommen. "Von Tag zu Tag wird mir klarer, dass ich schreiben muss, kann ich mich richtig auskotzen und alles machen, was ich nicht machen darf."
Einar Schleef gehörte auf seine private Weise zu den Ausbrechern der siebziger Jahre. An dem, was um ihn herum vorging - der Ponto-Mord, die Schleyer-Entführung, Stammheim -, nahm er nicht teil. Man stößt auf vorsichtige Zitate, sie benennen nur die Gegenwart um ihn herum. Schleef altert nicht; er wird nur älter, kräftiger, markanter, selbstbewusster. Aber warum zog der Flüchtling wieder nach Berlin zurück? "Ich kann ohne die Mauer nicht leben. Ich bin die Mauer. Gegen wen? Gegen mich selbst."
Am Ende des Tagebuches, nach den drei Jahren, liegt der erste Band gedruckt vor. "Der Sarg meiner Mutter" nennt er ihn hier. Es ist der erste große Schritt. Der nächste kam fünf Jahre später: ins Theater zurück. Da konnte er bauen, alle seine Talente zusammenführen. Die Bühne verlangte von ihm strenge Form. Da musste er sich selbst neu erschaffen. Das dritte Tagebuch zeigt nur die Wegstrecke, die zu gehen war bis zur nächsten.
Zwei Bände stehen noch aus. Unpolitisch erscheint dieser Lebensbericht aus brennender Zeit. Und führt doch ein Leben vor, das von der Politik geschlagen war und verwundet und, sich selbst begreifend, sich zurechtfinden musste in den beiden deutschen Welten.
Einar Schleef: Tagebuch 1977-1980. Wien Frankfurt a. M. Westberlin. Hrsg. von Winfried Menninghaus, Sandra Janßen, Johannes Windrich. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2007. 473 S., br., 30,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Günther Rühle bespricht - ach was, erleidet, den dritten Band von Einar Schleefs Tagebuch. Er nennt es eine "wuchernde Emanation" eines Lebens voller Chaos, Flucht, Umzug und - Arbeit. Das scheint bei allen Freund- und Feindschaften, die sich hier auch tummeln, der entscheidende Komplex zu sein, auf den Günther Rühle aufmerksam machen will. Die besessene Arbeit in Wien, Stuttgart, Frankfurt, Berlin und Düsseldorf, die Inszenierungen - begonnen in Ost-Berlin zusammen mit B.K. Tragelehn - finden hier ihren Niederschlag neben "drängenden Wortströmen" aus heftigsten Gefühlen, Verzweiflungen und Selbstkommentierungen. Begeistert, erschüttert und "schockiert" von all dem ist Rühle. Zitierend gönnt er uns eine kleine Schlüsselszene des Schreibens, nämlich die, wie Schleef in Wien der Schriftstellerin Hilde Spiel von seiner Mutter vorjammert, und sie ihn auf den Tisch hauend anschreit: "Dann schreiben Sie es auf." Daraus sei der Anfang zu dem Text "Gertrud" entstanden.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH