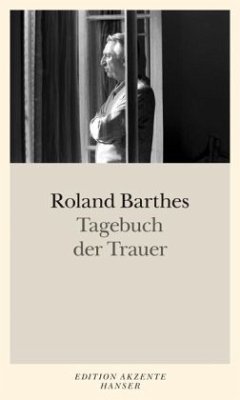Wem ein geliebter Mensch stirbt, dem fehlen die Worte. Roland Barthes, einer der anregendsten Denker aus dem Frankreich des 20. Jahrhunderts, suchte nach dem Tod seiner Mutter Trost in der Sprache. Auf etwa 250 Karteikarten hielt der Philosoph der Zeichen kurze Notizen fest, die um die Tote, die Trauer und um seine Einsamkeit kreisen. Im Juni 1978 brechen die Aufzeichnungen ab, die jetzt aus seinem Nachlass ediert wurden. Entstanden ist ein ungewöhnliches und bewegendes autobiografisches Zeugnis, das eindrucksvoll die Grenze zwischen der Trauer und der Sprache abtastet.

Dreißig Jahre nach dem Tod von Roland Barthes erscheint das Tagebuch, das der Trauer um seine verstorbene Mutter gewidmet ist: Es wirft auch Licht auf einige zentrale Motive seiner Schriften.
Am 28. Mai 1978 notiert Roland Barthes auf einer Karteikarte: "Die Wahrheit der Trauer ist ganz einfach: Jetzt, da Mam. tot ist, treibt es mich zum Tod (nur die Zeit trennt mich noch von ihm)." Tatsächlich hat Barthes, der vor dreißig Jahren an den Folgen eines Verkehrsunfalls starb, seine Mutter nur um zwei Jahre überlebt. Die knappe Notiz entstammt dem "Tagebuch der Trauer", das er einen Tag nach dem Tod seiner Mutter begonnen hat und das nun aus dem Nachlass veröffentlicht wurde. Ungewöhnlicher als der Eintrag vom Mai 1978 ist zunächst der Umstand, dass eine so persönliche Notiz überhaupt Teil der publizierten Schriften des Autors werden konnte. Schließlich war Barthes kein Romancier, Schauspieler oder Popstar, dessen Privatleben ohnehin öffentliche Aufmerksamkeit genoss, sondern Verfasser theoretischer Schriften und Professor für Literatursemiologie am renommierten Pariser Collège de France. Im Falle von Barthes erscheint die Publikation seines Tagebuchs allerdings aus mehreren Gründen folgerichtig - auch wenn die Frage, ob er dieser Veröffentlichung tatsächlich zugestimmt hätte, unentschieden bleiben muss.
Denn Barthes hat sich immer wieder an den Grenzen des akademischen Schreibens bewegt und ist das Risiko eingegangen, in der Rolle des Gelehrten von sich selbst zu sprechen: in der Autobiographie "Roland Barthes par Roland Barthes", in den "Fragmenten einer Sprache der Liebe", aber auch in seinem letzten größeren Buch "Die helle Kammer", das ausgehend von einer subjektiven Bilderauswahl eine Phänomenologie der Fotografie entwickelt. Wer diese Gratwanderung zwischen der Welt und sich selbst nicht beherrscht, wird mit seinem groß geschriebenen Ich leicht ins Peinliche oder Wichtigtuerische abdriften. Barthes hingegen hat diese Kunst wie kein anderer beherrscht. In seiner "intellektuellen Biographie" hebt Ottmar Ette zu Recht hervor, dass Barthes von sich selbst weniger als Individuum, vielmehr als Figur oder Fiktion spricht. So kommt in den autobiographischen Texten keine Privatperson zu Wort, sondern, wie es im "Tagebuch der Trauer" einmal heißt, "das verwüstete Subjekt, das Objekt seiner Geistesgegenwart ist". Der Schreibende betrachtet sich selbst als Objekt, die Introspektion ist gleichsam unpersönlich, wird aber gerade dadurch auf andere übertragbar.
Diese Diskretion des Autors zeigt sich umso deutlicher im Kontrast zu dem kürzlich erschienenen Buch "Der langsame Tod des Roland Barthes" des Journalisten Hervé Algalarrondo. Nach eigenen Angaben hat der Verfasser von den Schriften Barthes' nicht viel verstanden, interessiert sich stattdessen aber umso mehr für geplante Abmagerungskuren, Sexualpraktiken oder vulgärpsychologische Tiefenlektüren. In seinem Voyeurismus kommt Algalarrondo nicht über die Rolle des Paparazzo hinaus. Barthes hingegen wahrt selbst dort, wo er von emotionalen Zusammenbrüchen spricht, eine eigentümliche Distanz, die sich vor allem dem Willen zur Formalisierung seiner persönlichen Notizen verdankt.
Von Anfang an verbindet er das Tagebuch mit dem Nachdenken über die angemessene Sprache der Trauer. Bezeichnend ist seine Weigerung, die Trauer einem fertigen Vokabular, beispielsweise der Begrifflichkeit der Psychoanalyse, anzuvertrauen. Tatsächlich bietet sich viel eher ein Vergleich mit literarischen Texten an - etwa mit Peter Handkes einige Jahre zuvor entstandener Erzählung "Wunschloses Unglück". Auch wenn die Konstellation hier eine ganz andere ist, verbindet beide Texte die Art und Weise, wie der Tod der Mutter nicht zuletzt auch als Problem seiner Beschreibbarkeit zur Darstellung gelangt - als eine Arbeitsanstrengung des Schreibenden, "damit ich nicht einfach", so Handke, "wie es mir gerade entsprechen würde, mit der Schreibmaschine immer den gleichen Buchstaben auf das Papier klopfe". Wie sehr Barthes letztlich aber auch im Literarischen die Gefahr verspürt, die Trauer an sprachliche Konventionen zu verraten, zeigt folgender Eintrag: "Ich will nicht darüber sprechen, weil ich fürchte, es wird Literatur daraus."
Neben der sprachlichen Qualität des Textes ist seine Bedeutung für das Verständnis anderer Schriften des Autors hervorzuheben. Die formale Verdichtung und Knappheit mancher Notizen erinnert an Barthes' wiederholt beschriebene Faszination für das japanische Haiku. Auch die langjährige Beschäftigung mit Proust und dessen "Suche nach der verlorenen Zeit" erhält im Zeichen der Trauer eine zusätzliche Aktualität. Vor allem aber lässt sich das Tagebuch als heimlicher Subtext zu Barthes' Theorie der Fotografie lesen, die er zur gleichen Zeit in seinem Buch "Die helle Kammer" entwickelt hat.
Am 13. Juni 1978 verzeichnet das Tagebuch eine beiläufige Notiz: "Heute morgen mit großer Anstrengung die Photos wiederaufgenommen". In den folgenden Zeilen ist zum ersten Mal von der Fotografie der Mutter als fünfjähriges Mädchen im Wintergarten die Rede, deren Betrachtung wenig später zum Ausgangspunkt einer der einflussreichsten Fototheorien wird. Das Erscheinen des Tagebuchs macht jetzt noch deutlicher bewusst, wie sehr Barthes' Nachdenken über die Fotografie vom Tod des geliebten Menschen und dessen paradoxem Nachleben im Bild her gedacht ist. Die Einsicht, dass das Foto den dargestellten Menschen nicht belebt oder in die Gegenwart zurückholt, sondern im Gegenteil sein unverrückbares Gewesensein bezeugt, durchzieht das Tagebuch wie ein Grundton.
Neben der zur gleichen Zeit gehaltenen Vorlesung am Collège de France, die mit einem Seminar über Proust und die Fotografie enden sollte, erweist sich das "Tagebuch der Trauer" als ein weiterer Textbaustein, der zu verstehen gibt, wie sehr sich der Tod, die Fotografie und die Lektüre Prousts in den letzten Lebensjahren von Barthes zu einem System verdichtet haben, dessen Elemente sich gegenseitig stützen. Folgt man dem Tagebuch, war es ein Morgen im Juni, als Barthes auf das Kinderfoto seiner Mutter stieß. In der "Hellen Kammer" ist daraus "ein Novemberabend" geworden. Sagt der Verfasser hier also die Unwahrheit? Oder ist umgekehrt sein Tagebuch gar kein zuverlässiger und wahrhaftiger Text?
"Jede Biographie ist ein Roman, der seinen Namen nicht zu sagen wagt", hatte Barthes Jahre zuvor notiert. Das "Tagebuch der Trauer" ist ein weiterer Schritt im Entwurf eines Schreibens, in dem das Biographische Züge des Romans, das Literarische Züge höchster analytischer Klarheit trägt. Barthes macht es seinen Verehrern nicht leicht. Im "Tagebuch der Trauer" hält er der unbestimmten Nachwelt eine lakonische Notiz entgegen, der man wahrscheinlich Glauben schenken kann: "völlige Bereitschaft, restlos zu verschwinden, keine Lust auf ein ,Denkmal'".
PETER GEIMER
Roland Barthes: "Tagebuch der Trauer". Aus dem Französischen von Horst Brühmann. Hanser Verlag, München 2010. 272 S., br., 21,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Als "spröde Notizen" und "fragmentarisches Protokoll einer überwältigenden Verlassenheit" empfand Iris Radisch Roland Barthes' nach dem Tod seiner Mutter entstandene Aufzeichnungen, in denen sie aber wohl auch eine aufschlussreiche Ergänzung zu Barthes' Buch über Fotografie "Helle Kammer" sieht, das beinahe zur gleichen Zeit entstand und dessen verborgenes Zentrum ebenfalls die tote Mutter sei. Gleichzeitig handelt es sich bei diesen Aufzeichnungen aus Sicht der Kritikerin aber auch um eine Erlösungs- und Verklärungsarbeit des Philosophen, für den die "Mutter als Heilige" mit dem "Heiligen" im Werk des Sohnes korrespondiert. Zu den Erlebnissen mit diesem Text gehört für die Kritikerin die Erfahrung enormer Direktheit, da die "Unmittelbarkeit des Affekts" nahezu jeden Metatext unmöglich mache. Immer wieder porträtiere sich der Trauernde als "in weltverlorener Einsamkeit erstarrte Figur", zuweilen allerdings mit einer "Restdosis professoraler Parfümierung" wie die Kritikerin süffisant vermerkt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH