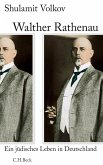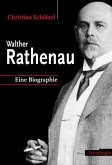In der Reihe der Tagebücher Carl Schmitts, die den Zeitraum von 1912 bis 1934 umfassen, schließt der vorliegende Band nun die Lücke von 1925 bis 1929. Er beschreibt die letzten Jahre Schmitts in Bonn und den Beginn seiner Lehrtätigkeit an der Handelshochschule Berlin. Dieser Übergang markiert eine deutliche Hinwendung des Theoretikers zur politischen Praxis des Regierens und stellt zugleich den Höhepunkt seines wissenschaftlichen Schaffens dar: In dieser Zeit entstehen seine zwei Hauptwerke »Der Begriff des Politischen« und die »Verfassungslehre«. Das Tagebuch wird durch die Fülle der beschriebenen Begegnungen Schmitts mit einflussreichen Persönlichkeiten jener Zeit zu einer wertvollen zeitgeschichtlichen Quelle.
Carl Schmitts Tagebücher sind ein ohne jeden Vorbehalt geschriebenes Diarium, das sich durch einen abbreviatorischen Charakter und eine gewisse stilistische Sorglosigkeit auszeichnet. Die nahezu unleserliche Schrift, in der es verfasst ist, deutet darauf hin, dasses der Autor ausschließlich für sich selbst geführt hat, als ein Mittel der Selbstvergewisserung. Die verführerische Klarheit des elaborierten theoretischen Werkes ist die notwendige Kehrseite des schnell und flüchtig Hingeworfenen im Tagebuch. Leben und Werk gehören bei Schmitt gerade in ihrer Gegensätzlichkeit eng zusammen.
Wie das vorhergehende und das nachfolgende Tagebuch besteht auch dieses aus dem eigentlichen Diarium und zwei Paralleltagebüchern, die den Gedankenstrom des Autors festhalten. Das Buch ist umfassend annotiert; zu zentralen Personen und Themen bietet es zudem einen Text- und Bildanhang.
Carl Schmitts Tagebücher sind ein ohne jeden Vorbehalt geschriebenes Diarium, das sich durch einen abbreviatorischen Charakter und eine gewisse stilistische Sorglosigkeit auszeichnet. Die nahezu unleserliche Schrift, in der es verfasst ist, deutet darauf hin, dasses der Autor ausschließlich für sich selbst geführt hat, als ein Mittel der Selbstvergewisserung. Die verführerische Klarheit des elaborierten theoretischen Werkes ist die notwendige Kehrseite des schnell und flüchtig Hingeworfenen im Tagebuch. Leben und Werk gehören bei Schmitt gerade in ihrer Gegensätzlichkeit eng zusammen.
Wie das vorhergehende und das nachfolgende Tagebuch besteht auch dieses aus dem eigentlichen Diarium und zwei Paralleltagebüchern, die den Gedankenstrom des Autors festhalten. Das Buch ist umfassend annotiert; zu zentralen Personen und Themen bietet es zudem einen Text- und Bildanhang.

Carl Schmitts Tagebücher aus den Jahren 1925 bis 1929
Er posiert mit einem Gewehr. Das wirkt wie ein schlechter Scherz. Bei aller Bedeutung, die Carl Schmitt der Unterscheidung von Freund und Feind beimaß: ein Waffennarr war er nicht. Wie er auch keine Affinität zum Militärischen und allzu sichtbaren Manifestationen der Macht besaß; abgesehen vom 1929 besuchten Schlosskloster Escorial, für deutsche Bildungsbürger damals eher ein gigantischer Steinhaufen denn ein Kunstwerk.
Gleichwohl ließ er sich 1927 im Garten seines Bonner Hauses mit Gewehr im Anschlag ablichten. Der Anlass war unkriegerisch. Eine Bande von Einbrechern hatte Bonn heimgesucht, auch Schmitt war in seiner großbürgerlichen Villa in Friesdorf, die 1934 der Gummibärenfabrikant Hans Riegel erwerben sollte und die heute, baulich fast unverändert, der Friedrich-Ebert-Stiftung gehört, deren Opfer geworden. Wie ein armer reicher Mann, der um sein Vermögen fürchten muss, erwarb er ein Gewehr und hielt im heimischen Garten Schießübungen ab. Über den weiteren Verlauf dieses häuslichen Ausnahmezustands ist nichts überliefert, womöglich nahm Schmitt das Gewehr noch nicht einmal 1928 nach Berlin mit.
Stoff, aus dem Anekdoten sind, bietet der fünfte und wohl abschließende Band der Tagebücher von Carl Schmitt mit Aufzeichnungen der Jahre 1925 bis 1929 reichlich. Etwa auch einen kuriosen Nachbarschaftsstreit um nächtliche Ruhestörung in der ersten Berliner Wohnung im Hansaviertel. Schmitt stammte zwar aus einer betont friedlichen Familie, aber irgendetwas zwang ihn, die Sache durchzufechten. Das großstädtische Leben sagte ihm erkennbar zu, er besuchte, fast wie in Lou Reeds "Perfect Day", den Zoo und die Gemälde des Kaiser-Friedrich-Museums, dazu war er ein fast manischer Kinogänger. Mindestens zehnmal sah er den 1928 uraufgeführten Stummfilm "Die Passion der Jungfrau von Orléans" des dänischen Regisseurs Carl Theodor Dreyer, wollte "alle Menschen zwingen, das großartig zu finden", wiederholt offenbar auch in Begleitung von Prostituierten, die Schmitt aber auch für typischere Dienste in Anspruch nahm.
Der Titel der Tagebücher könnte, frei nach einer "graphic novel" des Kanadiers Chester Brown, auch "Aufzeichnungen eines Freiers" heißen. Daneben unterhielt Schmitt nacheinander zwei Geliebte und führte eine von durchaus aufrichtigen Gefühlen begleitete zweite Ehe. In die gleiche Zeit fällt aber auch die Entstehung seiner berühmten "Verfassungslehre" von 1928. Angesichts der Edition eines früheren Tagebuchs zitierte nicht nur der Berliner Rechtshistoriker Dieter Simon den Theologen Wolfgang Spindler: "Man fragt sich wirklich, wann er gearbeitet hat." Da wird mancher Kollege neidisch.
Die jüngste Edition, deren sorgfältige Herausgeber Gerd Giesler und Martin Tielke angesichts der von Schmitt gebrauchten Gabelsbergerschen Kurzschrift oft an ihre Grenzen kamen, zeigt aber auch einen eklatanten Wandel. Noch vor zwanzig Jahren, Schmitt war schon lange tot, wäre so eine Edition auf grundsätzliche Kritik gestoßen: hat ein "Kronjurist" des Dritten Reichs, der nicht nur die Röhm-Morde rechtfertigte, so eine fast schon liebevolle Edition seiner intimsten Aufzeichnungen verdient? Die Herausgeber waren dabei redlich bemüht, nicht in die Nähe der Hagiographie zu geraten. Sie distanzieren sich von Schmitts Antisemitismus in aller Schärfe, beschönigen nichts und finden die Beschreibung körperlicher Vorgänge so, wie sie auf den Leser tatsächlich wirken: ermüdend.
Den gleichen Effekt haben auch thematisch verwandte Selbstbespiegelungen des Diaristen Thomas Mann. Aber auch mancher, der die Bedeutung von Schmitt als politischem Denker nicht bestreiten will, wird fragen: Will man das alles so genau wissen? Die Antwort fällt deutlich aus: gerade deswegen. Die Gelegenheit, so in das Innere eines Intellektuellen des zwanzigsten Jahrhunderts zu blicken, zumal eines, dessen internationaler Einfluss kaum bestritten werden kann, bietet sich nicht so oft.
Womöglich werden spätere Generationen, wenn ein neuer "cultural turn" aufgetaucht ist, diese Tagebücher noch einmal ganz anders lesen. Die Gefahr, dass Schmitt dadurch zur Kultfigur wird, ist eher gering; wäre da nicht das Werk, nähme man die teils wehleidigen, teils euphorischen Notate kaum zur Kenntnis.
Doch im Kontext mit dem Werk wird es interessant. Nur dass der Briefwechsel Schmitts mit Hermann Heller, der eine Zeitlang eine unfreiwillige postume Konjunktur als sozialdemokratischer Gegenspieler Schmitts hatte, als eine Art Appendix abgedruckt, etwas eingeschoben wirkt, ist schade. Vor zwanzig Jahren wäre der scharfsinnige Linkshegelianer und nationale Sozialdemokrat Heller wohl prominenter hervorgehoben worden. Die Zeiten ändern sich und "Schmitt sells". Es sind die Gesetze des Marktes, die Schmitt wie Heller nicht ohne Misstrauen beobachteten.
MARTIN OTTO
Carl Schmitt:
"Tagebücher 1925 bis 1929".
Hrsg. von Martin Tielke und Gerd Giesler.
Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2018.
545 S., Abb., geb., 79,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Die Gelegenheit, so in das Innere eines Intellektuellen des zwanzigsten Jahrhunderts zu blicken, zumal eines, dessen internationaler Einfluss kaum bestritten werden kann, bietet sich nicht so oft.[...]" Dr. Martin Otto, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Sachbücher, Seite 10, Nr. 130 vom 08.06.2018