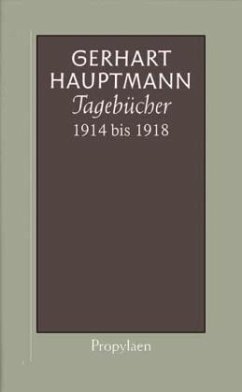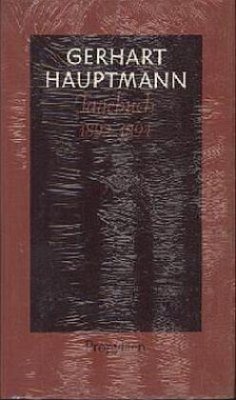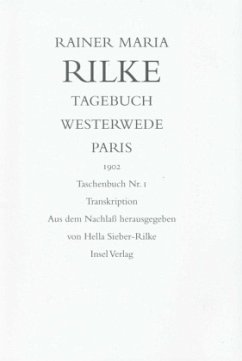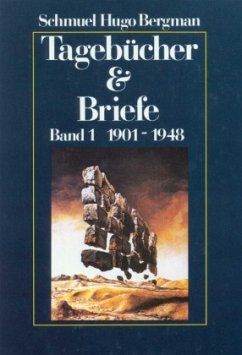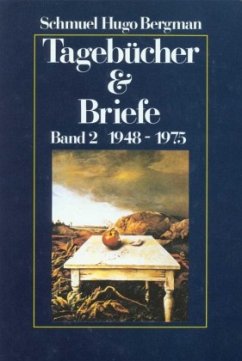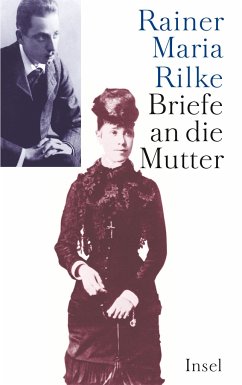Marie L. Kaschnitz
Buch mit Leinen-Einband
Tagebücher 1936 - 1966, 2 Teile
Nachw. v. Arnold Stadler
Mitarbeit: Büttrich, Christian; Büttgen, Marianne; Schnebel-Kaschnitz, Iris
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





18 Tagebuch-Hefte (in zwei Bänden) werden hier erstmals veröffentlicht. Sie enthalten Eintragungen aus den drei Jahrzehnten zwischen 1936 und 1966 - in sehr unterschiedlicher Dichte und unterschiedlicher Nähe zum eigenen Erleben.
Kaschnitz, Marie LuiseMarie Luise Kaschnitz wurde am 31. Januar 1901 in Karlsruhe geboren und wuchs in Potsdam und Berlin auf. Nach einer Ausbildung zur Buchhändlerin arbeitete sie beim O.C. Recht Verlag in München und in einem Antiquariat in Rom. Nachdem sie den Archäologen Guido Kaschnitz von Weinberg geheiratet hatte, begleitete sie ihn auf mehrere seiner Forschungsreisen und wohnte u.a. in Rom, Marburg und Königsberg, nach 1941 vor allem in Frankfurt am Main. Nach der Geburt ihrer Tochter 1928 begann sie zu schreiben - Romane, Erzählungen, Essays und Gedichte. Ihr erster Roman Liebe beginnt erschien 1933. Ab 1950 widmete sie sich zudem zunehmend dem Hörspiel. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und war Mitglied u.a. des P.E.N.-Zentrums der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Sie starb am 10. Oktober 1974 in Rom.
Produktdetails
- Verlag: Insel Verlag
- 2000.
- Seitenzahl: 1338
- Deutsch
- Abmessung: 212mm x 139mm x 66mm
- Gewicht: 620g
- ISBN-13: 9783458169710
- ISBN-10: 3458169717
- Artikelnr.: 08204981
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Gerade das "Punktuelle" und Unfertige gefällt Walter Hinck an den Tagebuchnotizen der Lyrikerin. Mit Sympathie zeichnet er ihren Weg nach - geboren in der Hocharistokratie, angeekelt vom Nationalsozialismus, allem Neuen in der Kunst aufgeschlossen, aber auf selbstverständliche Art, so Hinck, weltläufig und den Kontakt mit den wichtigsten Künstlern und Intellektuellen ihrer Zeit pflegend. Hinck weist auf die Bedeutung hin, die sie für Paul Celan hatte, für den sie die Preisrede hielt, als er den Büchner-Preis erhielt. Auch die Freundschaft zu Adorno finde in einigen Einträgen Eingang in dieses Tagebuch. Im übrigen lobt Hinck das Tagebuch als "Vorratskammer" und "Rohstofflager" für ihre Dichtung. Wer ihre Gedichte kenne, so Hinck werde hier auf interessante Urformen und Skizzen treffen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Ich schreibe an der Universität in Mailand eine Schlussarbeit über M.L. Kaschnitz und bin auf diese Tagebücher gestossen, für meine Arbeit ist sie in vieler Hinsicht sehr aufschlussreich. Ich habe viele Zusammenhänge besser verstehen können. Ich glaube für die …
Mehr
Ich schreibe an der Universität in Mailand eine Schlussarbeit über M.L. Kaschnitz und bin auf diese Tagebücher gestossen, für meine Arbeit ist sie in vieler Hinsicht sehr aufschlussreich. Ich habe viele Zusammenhänge besser verstehen können. Ich glaube für die Interpretation dieser Autorin ist die Veröffentlichung der Tagebücher sehr wichtig gewesen.
Weniger
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für