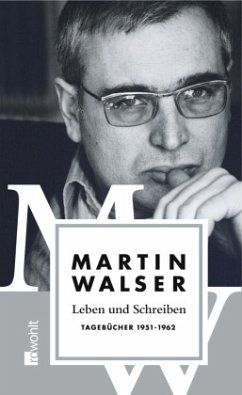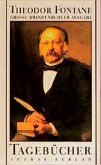Im September 1951 - dem Monat, mit dem Martin Walsers Tagebücher beginnen - ist er 24, und Jahre trennen ihn von seinem ersten Buch. "Noch kann mich niemand kennen. Ich bin noch nicht da" schreibt er in dieser frühen Zeit. Er berichtet von Romanen und Romanideen, von Reisen und Sylvesterpartys, von Krankenhausaufenthalten, Begegnungen, Gesprächen. Sein Tasten und anfängliches Zweifeln als Autor finden sich ebenso darin wie sein Lebenshunger und der Wunsch, die "freundlich-schmerzlichen Wege weiterrutschen und die Welt wie ein Beerenfeld leer essen" zu können. Er erzählt vom "Abschlachten von Erwartungen", von der "Sucht der Sehnsucht", vom Schreiben als "Spielen vor einem Altar". Doch Martin Walser ist ein Verwandlungskünstler: Er verwandelt das Leben in Literatur. Stets werden seine Romane für autobiographisch gehalten, selten zu Recht. Wer nun seine Tagebücher aufschlägt, erkennt, dass sogar sie eher Dokumente seines Schreibens als seines Lebens sind. Genau dies macht sie zu einem Kunstwerk von hohem Rang.

Spielen vor einem leeren Altar: Martin Walsers frühe Tagebücher
"Bloß probieren, ob ich's sagen kann. Nicht hellwach sein. Die Hand soll's allein versuchen. Später beteilige ich mich. Oder nicht." 1952 war Martin Walser ein ehrgeiziger junger Schriftsteller, der noch nicht wußte, wohin ihn seine Schreibhand einmal tragen würde. "Bei nächster Gelegenheit werden wir. Das ist sicher. Bloß was?" Der Weg war das Ziel, aber Gangart, Haltung und Ausdauer mußte der kommende Schmerzensathlet erst noch trainieren. "Mein Dasein und mein Schreiben berühren sich nur ganz selten und dann nur flüchtig und mit Scham": So schrieb ein Kafka- und Beckett-Epigone, dem die Parabeln und Grotesken nur so zuflogen. Jedes Frage- war ein Ausrufezeichen, jede Niederlage ein Sieg seiner "wohlkalkulierten Schwäche" und "abgefeimten Wehrlosigkeit": "Morgens lüge ich. Mittags sage ich die Unwahrheit. Abends erfinde ich etwas Passendes. So komme ich ganz gut durch."
Aber so blieb es nicht. "Wie war das Schreiben leicht und mühelos, als ich aus Kafka eine Manier machte", notiert Walser 1957. "Damals war jede noch so absichtslose Bewegung gesichert. Inzwischen ist alles gefährlich geworden und voller Risiko. Ich überlege alles, wahrscheinlich zuviel. Der Mut hat mich verlassen." Walser hatte sein Thema gefunden: die narzißtisch-masochistische "Selbstbeobachtung beim Leiden", gespiegelt in der Seelenarbeit der Angestellten, Aufsteiger und Liebhaber, die er in seinen Rundfunkreportagen und auf seinen Reisen durch die Wirtschaftswunderrepublik kennengelernt hatte. "Gefährlich" war dieses Schreiben nur insofern, als es jederzeit in zirzensische Leidensakrobatik abstürzen konnte. "Zur Zeit ist meine Schreiberei ein Spielen vor einem Altar, ich will bemerkt werden, und ich will mich abhalten, ihn zu berühren. Ich will mich müdespielen, ich will zuviel tun, bis ich einen Ekel empfinde und ruhig in mein Zimmer zurückkehren kann, mit milder Verachtung und Mitleid gegenüber der Welt und mir selbst."
Das Spielen vor dem leeren Altar ist Walser nie schwergefallen. Die "Tagebücher" zeugen von einem produktiven, sich selbst verzehrenden Hunger nach Fakten, Erfahrungen und Stimmungen, der ihn zum Chefdokumentaristen seiner Zeit machte. "Schreiben bis zur Ohnmacht" hieß: Selbstermächtigung durch Demut und Zerknirschung; das Tagebuch war Beichtstuhl und Absolution dieses Ekels. "Nichts Schlimmeres als das regelmäßige Tagebuch, auch wenn es gar nicht zur Veröffentlichung bestimmt ist, aber welches ist das nicht! Das schleicht sich ganz von selbst in den kleinschreibenden, sorgfältig notierenden Geist ein, die Korrumpierung ist unvermeidbar. Mich kotzt es an, mich mit diesem Papier unterhalten zu müssen. Aber ich habe nichts anderes. Also schmiere ich mich selbst wie schlechte Marmelade aufs Papier. Klebrig. Süßlich. Ekelhaft . . . Es lebe die schlimmste aller Posen: die willenlose Beschäftigung mit einem leergewordenen Selbst."
Obsessiv und erotomanisch, aber kalt bis ans Herz, entwirft Walser funkelnde Prosaskizzen, Porträts und Monologe, die in seine frühen Erzählungen und Romane eingehen werden. Alles ist ihm Spielmaterial, nichts existentielle Notwendigkeit, unhintergehbares Bedürfnis, fester Glaube oder auch nur unverrückbare "Meinung". Walser läßt sich von und in der Sprache überwältigen, von seiner Hand flüssig vorschreiben, was sein Kopf skeptisch durchkonjugiert. Die Leichtigkeit des Schreibens macht es ihm selbst verdächtig, zu einem Quell von Scham und Schuld: "Wenn ich Gott wäre, würde ich meinen Gebeten mißtrauen. Beten ist schwer, weil ich gut im Formulieren bin. Mir kommt kein Wort unbesehen, unbespiegelt, ungenossen von den Lippen. Ich bin ein Friseur. Daran kann Gott keine Freude haben."
Der Leser schon. Walsers Tagebücher sind eine Fundgrube brillanter Etüden, Miniaturen, Aphorismen und kryptischer Andeutungen ("Wenn das so weitergeht mit den Mädchen, mein Gott"). Für Walser geht das Leben im Schreiben auf: Was ihn nicht zum Ausdruck reizt, existiert nicht, aber alles, was ist, drängt ihn zur Beschreibung oder wenigstens Dokumentation: ein verrutschter Frauenrock, ein flüchtiger Blick im Zugabteil, Speisekarten und Schlagertexte, die Psychologie eines Polterabends in der Provinz oder eine Silvesterparty in Berlin.
Die Stationen von Walsers exoterischer Biographie - die Männerfreundschaft mit Siegfried Unseld, das Engagement für Willy Brandt, Begegnungen mit Ingeborg Bachmann oder einem gewissen Herrn Kohl aus Mainz - tauchen nur in esoterisch dürren (und leider unzureichend kommentierten) Notizen auf. Walser macht, auch in seinen Tagebüchern, keinen Unterschied zwischen Mitteilung und Literatur, privatem Bekenntnis und öffentlicher Rhetorik. Ich ist, wie bei seinem Alter ego Meßmer, "Er" (oder auch, vor allem im Umgang mit Frauen, "man"), die Tagebuchprosa durchschossen von lyrischem Pathos, scharfzüngigen Paradoxa, Romanen in einer Nußschale, mit panischer Buchhaltung und manischem Gekritzel. Wir schauen dem Dichter bei der allmählichen Verfertigung seiner Gedanken beim Schreiben zu; aber von seinem Leben als Familienvater, Liebhaber, Journalist oder "Gruppe 47"-Mitglied erfahren wir weniger als über seinen Hund oder die Mechanik der Melkmaschine.
Walser schreibt auf dem Marktplatz, als ob er zu Hause wäre: intim (aber nicht indiskret), privat (aber seiner Wirkung wohlbewußt), rücksichts- und absichtslos (aber nie ohne Hintergedanken). In seinem Bodensee ist er Kapitän und Leichtmatrose, Badegast und Rettungsschwimmer, jedenfalls sich selbst genug. Er ist sein einziger Leser, sein erster Kritiker: ein begnadeter Selbstverhinderungskünstler, der sich dauernd anklagt, freispricht und für das verurteilt, was er eben noch wortgewaltig verteidigte. So klettert er wie ein Affe an sich hoch, um von oben herab Gerichtstag über seine Kleinheit zu halten: "Ich bin nichts als ein landschaftlich gebundener Impressionist mit ein paar panischen Empfindungen, die mich, weil ich ihnen nicht nachhören, sie nicht ausdrücken kann, schließlich zum Ersatz-Moralisten machen."
Im Grunde ist Walsers ganzes Werk ein endloses Tagebuch, das sein Leben im Schreiben zersetzt und aufhebt. Dieses ist, gerade in seiner Vor- und Beiläufigkeit, konzentrierter, angriffslustiger, zärtlicher und aufrichtiger als das meiste, was er zuletzt geschrieben hat, kurz: sein eigentlicher Lebensroman. "Gegen mich müßte geschrieben werden", notiert Walser 1955 tragisch beglückt. "Ich habe Züge einer negativen Romanfigur."
MARTIN HALTER
Martin Walser: "Leben und Schreiben". Tagebücher 1951-1962. Rowohlt Verlag, Reinbek 2005. 667 S., geb., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Eine "Fundgrube brillanter Etüden" - so begrüßt ein begeisterter Rezensent Martin Halter Martin Walsers frühe Tagebücher, die er gerade auf Grund ihrer "Vor- und Beiläufigkeit" interessanter als das meiste findet, was dieser Autor in den letzten Jahren geschrieben hat. Walsers Tagebücher seien sein "eigentlicher Lebensroman", schreibt Halter und schaut beim Lesen mit Faszination diesem Autor bei "der allmählichen Verfertigung seiner Gedanken beim Schreiben" zu. Er sieht Walser dabei getrieben von Ekel und Fakten- und Erfahrungshunger zum "Chefdokumentaristen seiner Zeit" werden. Über das Privatleben dieses Autors erfährt der Kritiker hier dagegen wenig. Das, was über Freunde, Bekannte und Weggefährten enthalten sei, bedürfe einer editorischer Erläuterung. Auf die Mängelliste setzt der Rezensent daher die "unzureichende Kommentierung" dieser Tagebuchaufzeichnungen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH