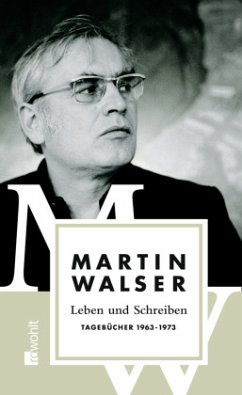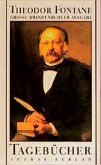Der zweite Band von Martin Walsers Tagebüchern: Einblick in Leben und Schreiben der 60er Jahre.
«Martin Walsers Tagebücher sind eine Fundgrube brillanter Etüden, Miniaturen, Aphorismen und kryptischer Andeutungen», hieß es in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» über den ersten Band. «Für ihn geht das Leben im Schreiben auf: Was ihn nicht zum Ausdruck reizt, existiert nicht, aber alles, was ist, drängt ihn zur Beschreibung oder wenigstens Dokumentation: ein verrutschter Frauenrock, ein flüchtiger Blick im Zugabteil, Speisekarten und Schlagertexte, die Psychologie eines Polterabends in der Provinz oder eine Silvesterparty in Berlin.» Nun geht es mit dem zweiten Band der Tagebücher weiter. Er beginnt 1963, nicht lange vor der Eröffnung des Frankfurter Auschwitz-Prozesses. Martin Walser besucht die Gerichtsverhandlungen, hält Eindrücke fest, protokolliert das Furchtbare, es entsteht der Aufsatz «Unser Auschwitz». Reisen nach Moskau, Erewan, Tibilissi und Trinidad, aber auch Reisen kreuz und quer durch Europa werden zum Schreibanlass. Und immer wieder das Schreiben selbst: «Erzählen - der Versuch, mit geschlossenem Mund zu singen.»
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
«Martin Walsers Tagebücher sind eine Fundgrube brillanter Etüden, Miniaturen, Aphorismen und kryptischer Andeutungen», hieß es in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» über den ersten Band. «Für ihn geht das Leben im Schreiben auf: Was ihn nicht zum Ausdruck reizt, existiert nicht, aber alles, was ist, drängt ihn zur Beschreibung oder wenigstens Dokumentation: ein verrutschter Frauenrock, ein flüchtiger Blick im Zugabteil, Speisekarten und Schlagertexte, die Psychologie eines Polterabends in der Provinz oder eine Silvesterparty in Berlin.» Nun geht es mit dem zweiten Band der Tagebücher weiter. Er beginnt 1963, nicht lange vor der Eröffnung des Frankfurter Auschwitz-Prozesses. Martin Walser besucht die Gerichtsverhandlungen, hält Eindrücke fest, protokolliert das Furchtbare, es entsteht der Aufsatz «Unser Auschwitz». Reisen nach Moskau, Erewan, Tibilissi und Trinidad, aber auch Reisen kreuz und quer durch Europa werden zum Schreibanlass. Und immer wieder das Schreiben selbst: «Erzählen - der Versuch, mit geschlossenem Mund zu singen.»
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Die Jahre, die wir so noch nicht kannten: Martin Walser sammelt in den Tagebüchern 1963 bis 1973 den Wortschatz für seine Kämpfe / Von Jochen Hieber
Am 24. März 1963 wird Martin Walser sechsunddreißig Jahre alt. Er ist ein immer noch aufstrebender, zugleich schon arrivierter und bekannter Autor. In den zurückliegenden Jahren hat er einige renommierte Literaturpreise erhalten, als nicht eben schüchternes Mitglied der Gruppe 47 trägt er zu deren beträchtlicher öffentlicher Wirkung bei und profitiert davon auch selbst. Vor allem mit den beiden Romanen "Ehen in Philippsburg" (1957) und "Halbzeit" (1960) hat er Aufsehen erregt, vor wenigen Monaten hat in Berlin die Premiere von "Eiche und Angora" stattgefunden, seinem Theaterstück über den Nationalsozialismus und den Nachkrieg. Nun, am Geburtstag, notiert er gleichwohl melancholisch ins Tagebuch: "Wenn er an sein Leben denkt, spürt er sofort Magenschmerzen."
Wer aber denkt hier, wer hat Schmerzen? Der Autor, von sich in der dritten Person schreibend? Oder eine neue Romanfigur, die er gerade entwirft? In den Anmerkungen zum Band "Leben und Schreiben. Tagebücher 1963-1973" bleibt, wie viele andere, auch diese Stelle unkommentiert und damit in der Schwebe. "Er bringt wieder eine Tochter in die Schule", heißt es knapp vier Jahre später, also im Februar 1967, "sie weigert sich, das Auto zu verlassen, weil sie zwei Minuten zu spät ist." Auch hier wird man nicht recht schlau, weder auf Anhieb noch überhaupt: Vater Walser, Vater wer? Das mag zunächst etwas irritieren. Aber nach einiger Gewöhnung entwickelt just die in vielen Passagen nicht aufzulösende Ungewissheit, von wem die Tagebücher nun gerade Zeugnis ablegen, einen eigentümlichen Reiz.
Natürlich ist in Notaten wie jenem vom 9. April 1963 - "Osnabrück. Lesung. Hotel Reichshof. Lebergallekranker Veranstalter" - sofort klar, dass Walser selbst, Jahrzehntelang der lesereisefreudigste aller deutschen Schriftsteller, mal wieder unterwegs ist. Aber wenn unter dem über die Jahre hinweg immer wieder auftauchenden Rubrum "Befürchtungen" etwa im Mai 1964 zu lesen ist: "Der einzige Grund dafür, daß ich jetzt anfange, alles aufzuschreiben, ist mein 50. Geburtstag", so kann es sich unmöglich um den Autor handeln, denn der ist jetzt eben siebenunddreißig geworden.
Walser hat in seinen Tagebüchern also zunächst mit sich selbst Vexierspiele der Identität veranstaltet - nun, da er sie veröffentlicht, treibt er sie eben auch mit uns. Warum das in den Anmerkungen jeweils erläutern und damit den Reiz schmälern? Wann immer das Tagebuch pragmatischen Zwecken dient, unterrichtet uns der Kommentar von Jörg Magenau denn auch knapp, aber ausreichend. Und ganz pragmatisch dient Walser das Tagebuch zu vielem zugleich: als Privatbühne des Ich, Aktualitätsprotokoll, bloße Kritzelstube, geräumige Gedichtekammer, Experimentierkasten, Entwurfskladde, Aphorismenlabor, kurzum, so Magenau, als "Materiallager". Zwischen 1963 und 1973 plant Walser etwa die Romane "Matrosenleben" und "1983", das Theaterstück "Ein Pferd aus Berlin" oder die Prosa "Prinz Helmut". Ausprobiert werden Anfänge, einzelne Szenen und Figuren: Es wird aus allem nichts. Anderes, wie "Zappels Glück", verwandelt sich in den Einakter "Zimmerschlacht", 1967 uraufgeführt, oder geht, wie das Projekt "Cousine", in den Roman "Der Sturz" (1973) ein.
Anders als im 2006 erschienenen ersten Tagebuchband, der die Jahre 1951 bis 1962 und damit die Anfänge dieses Autors umfasste, ist sich der Diarist nun sehr bewusst, auch eine öffentliche Figur zu sein. Es ist das Jahrzehnt des Frankfurter Auschwitz-Prozesses und des Vietnam-Kriegs, des sich zuspitzenden Ost-West-Konflikts und der Studentenbewegung, der Notstandsgesetze ebenso wie der Mondlandung. Und Walser mischt sich kräftig ein. Er ist 1966 Mitbegründer des "Vietnam Büros" in München. Er ist es, der 1967 während der Tagung der Gruppe 47 den Boykott gegen die "Springer-Presse" formuliert. 1970, auf dem Gründungskongress des Verbands deutscher Schriftsteller, fordert er gleich das große Ganze: eine "Industriegewerkschaft Kultur".
Aber er laviert sich auch durch. Beim berühmt-berüchtigten Lektorenausstand im Suhrkamp Verlag kurz nach der Buchmesse 1968 unterstützt er, der in jenen Jahren am liebsten alles "sozialisieren" will, im Grunde die Rebellen, um schließlich doch dem Verleger und Freund Siegfried Unseld zur Seite zu springen. Zeitweise nähert er sich der Deutschen Kommunistischen Partei an, ohne deshalb deren wahren Herren in Ost-Berlin und Moskau nach dem Munde zu reden. Rein literarisch betrachtet, sind diese Jahre seine besten beileibe nicht. Zwar schafft es Walser mit dem Roman "Das Einhorn" (1966) auf die Spitzenplätze der "Spiegel"-Bestsellerliste: Montag für Montag hält das Tagebuch die jeweilige Plazierung fest. Die nachfolgende Erzählung "Fiction" (1970) aber findet bei den Kritikern ebenso wenig Anklang wie in den Buchhandlungen, den Romanen "Die Gallistl'sche Krankheit" (1972) und "Der Sturz" ergeht es kaum besser. Und als er im Sommer 1971 Siegfried Unseld einen Packen politischer Gedichte schickt, betitelt "Der Grund zur Freude. 99 Sprüche zur Erbauung des Bewußtseins", schlägt der Verleger entsetzt die Hände über dem Kopf zusammen. Walsers ohne Zweifel bedeutendster Text aus jenen Jahren ist der Essay "Unser Auschwitz" (1965), den er nach dem Ende des Frankfurter Prozesses schreibt.
Natürlich finden all diese Ereignisse ihren Nachhall in den Tagebüchern. Aber ob wiederkehrende Kritikerbeschimpfungen, Notizen über die heftigen Kräche mit dem Kollegen und Freund Uwe Johnson, ob die Polemik gegen Günter Grass, "eingehüllt" in den "Hermelin seines Ruhms", ob die Kritik an Willy Brandt wegen dessen angeblich zu großer Amerika-Nähe oder das Benennen des eigenen, schon damals erwachten Deutschland-Gefühls - "Traurig BRD und DDR", heißt es am 9. April 1968 -: All diese Nachklänge wirken seltsam verhalten angesichts der lange bekannten Äußerungen, die Martin Walser damals direkt in Interviews und Artikeln machte. Mit Recht weitaus dramatischer lesen sich denn auch die Kapitel in Jörg Magenaus Walser-Biographie von 2005, die jenen Jahren gewidmet sind: Hier geht es in der Tat um den "Wortschatz unserer Kämpfe", den Walser weiland zu einer Hörspiel-Etüde verarbeitete.
Der Tagebuchschreiber hatte zugleich entschieden anderes im Sinn: Er nutzte das intime Medium, um sich selbst und seiner öffentlichen Rolle permanent zu widersprechen. Nur so, das scheint er zu spüren, kann er ganz bleiben, bei allem Vexierspiel mit den Identitäten identisch mit sich selbst. Also bleibt "Der Rachekalender", den er im Sommer 1964 anlegt, fast völlig leer, also findet sich im Januar 1968 ein Dreizeiler radikaler Zurücknahme: "O politisches Gedicht / Totengedicht / mehr bist du nicht." Walser, einer der besonders engagierten Autoren der Epoche, polemisiert im Tagebuch: "Heute verlangt jeder Literatur-Nachtwächter vom Schriftsteller Engagement wie einen Arier-Ausweis." Er weiß: "Es kommt darauf an, in welchem Hotel man sich erholt, nicht, für wen man kämpft." Er weiß auch: "Sagte ich jemandem, was ich von mir halte, spräche sich das herum und ich könnte meinen Laden zumachen. Also weiter." Und durchaus nicht nur selbstironisch versammelt er, was er eigentlich braucht: "Geld, Gesundheit, Ruhe, Frauen, Wechsel, Beliebtheit, Verehrung, etwas Ruhm, etwas mehr Ruhm, allen Ruhm und eine neue Sommerhose."
Das literarische Glanzstück dieser Tagebücher stammt aus dem Sommer 1969. Siegfried Unseld unterhält sich mit einem gewissen "R. G.", Bewerber um eine Stelle in der Werbeabteilung des Verlags. Der Dialog ist von so irrwitziger Komik, dass er eigentlich nur erfunden sein kann. Sehr real hingegen ist, wenige Monate zuvor, ein Besuch des Südwestfunk-Redakteurs Jürgen Lodemann, der Walser ein schönes Angebot unterbreitet: Dieser solle mit einem Kamerateam Goethes "Italienische Reise" noch einmal machen. Sehr bezeichnend für den klassenkämpferischen, den öffentlichen Walser jener Tage: Er lehnt ab, denn er "möchte lieber durchs Ruhrgebiet fahren". Das macht er dann auch. Er hat es bitter bereut.
Im April 1967 stirbt Walsers Mutter. Über weit mehr als zwanzig Seiten hinweg hebt der Tagebuchschreiber nun zu einer so ergreifenden wie erschütternden Totenklage an. "Sie kennen den Verlust nicht", heißt es einmal über die Trauergäste. Nur sein Bruder Karl und er selbst wüssten, wie groß er sei - "und wir sprechen nicht darüber". Im Tagebuch hat er es getan. Und nur hier war es möglich. Nirgendwo sonst in Walsers Werk findet sich eine Passage von derart unverstellter, elementarer Wucht. Schon allein um dieser Seiten willen soll man die Aufzeichnungen lesen.
Martin Walser: "Leben und Schreiben". Tagebücher 1963-1973. Mit Anmerkungen von Jörg Magenau. Rowohlt Verlag, Reinbek 2007. 719 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Für Rezensent Arno Widmann ist die herausragende Eigenschaft dieser Tagebücher die Präsenz ihres Autors darin. Deswegen hat ihn auch weniger interessiert, was Martin Walser im und zum Signaljahr 1968 zu sagen hatte, als seine Selbstauskünfte in Sachen Beobachtungslust, Aufschreibwut und literarischen Arbeitsweisen. Natürlich liest Widmann dann doch interessiert Walsers Bemerkungen zum Vietnamkrieg, den Studentenprotesten und seine Kritik an der Radikalität des SDS, freut sich am Ende aber doch am meisten über Walsers Ausführungen über das Kunstmachen und den Künstler an sich.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH