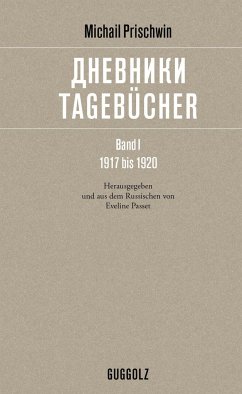Michail Prischwin (1873-1954) schrieb seine Tagebücher unter dem Sowjetregime im Verborgenen. Mit diesem heimlichen Schreiben wollte er sichergehen, dass er nicht in politische Schwierigkeiten geriet, doch es ging ihm ebenso sehr auch um psychischen Selbstschutz: Die Tagebücher sind ein Versuch, den eigenen weltwahrnehmenden Blick, das eigene Fühlen und Denken und die eigene Sprache freizuhalten von den Korruptionen, denen viele unterlagen aus Angst, aus Glaube oder aus mangelnder Kraft, in Diskrepanz zur Umgebung zu leben.
Prischwins Tagebücher bilden ein Mosaik aus Alltagserlebnissen, Begegnungen mit berühmten wie einfachen Menschen, Betrachtungen zur Literatur und Philosophie, Träumen, Naturschilderungen, Skizzen zu literarischen Arbeiten und vielem mehr. Aber vor allem verzeichnen sie kleinste Mutationen des politisch-gesellschaftlichen Lebens und deren Niederschlag im einzelnen Menschen und in der Sprache. In den Tagebüchern ist "Leben gesammelt" wie in Victor Klemperers Tagebüchern, mit denen sie manches gemeinsam haben.
Eveline Passet stellt aus 18 russischen Bänden mit 13.000 Seiten eine vierbändige Auswahl zusammen, die sie übersetzt und kommentiert. Der erste Band reicht von 1917, dem Jahr der Februar- und der Oktoberrevolution, bis 1920, jenem Bürgerkriegsjahr, das den Sieg der Bolschewiki besiegelte. Darin zeigt sich ein Mensch, der das, was um ihn herum passiert, mitdenkt und zu verstehen versucht. Er leidet an den Zeiten und schafft es doch, selbst in Bedrängnis, sich zur Welt - auch der jenseits des Politischen gelegenen - mit aller Wahrnehmungskraft zu öffnen.
Prischwins Tagebücher bilden ein Mosaik aus Alltagserlebnissen, Begegnungen mit berühmten wie einfachen Menschen, Betrachtungen zur Literatur und Philosophie, Träumen, Naturschilderungen, Skizzen zu literarischen Arbeiten und vielem mehr. Aber vor allem verzeichnen sie kleinste Mutationen des politisch-gesellschaftlichen Lebens und deren Niederschlag im einzelnen Menschen und in der Sprache. In den Tagebüchern ist "Leben gesammelt" wie in Victor Klemperers Tagebüchern, mit denen sie manches gemeinsam haben.
Eveline Passet stellt aus 18 russischen Bänden mit 13.000 Seiten eine vierbändige Auswahl zusammen, die sie übersetzt und kommentiert. Der erste Band reicht von 1917, dem Jahr der Februar- und der Oktoberrevolution, bis 1920, jenem Bürgerkriegsjahr, das den Sieg der Bolschewiki besiegelte. Darin zeigt sich ein Mensch, der das, was um ihn herum passiert, mitdenkt und zu verstehen versucht. Er leidet an den Zeiten und schafft es doch, selbst in Bedrängnis, sich zur Welt - auch der jenseits des Politischen gelegenen - mit aller Wahrnehmungskraft zu öffnen.

Das erste Jahrzehnt der Sowjetunion war ein literarisches Dorado unter Terror. Das zeigen ein Roman von Olga Forsch und Michail Prischwins Tagebücher.
In den Memoiren der russischen Schriftstellerin Nina Berberowa tritt deren Kollegin Olga Forsch nur wenige Male auf. Aber gleich beim ersten Mal mit Aplomb, denn da wird sie vorgestellt als die kommende Autorin eines Buchs, das als Schlüsselroman über die Petrograder Literaturszene in den ersten Jahren nach der Oktoberrevolution zu lesen sei; einen Titel aber nennt Berberowa nicht. Wozu auch? Olga Forschs Roman war 1972, als Berberowas Autobiographie erstmals erschien, kaum greifbar. 1930 war er in der Sowjetunion erschienen, danach dauerte es bis 1988, ehe er dort wieder gedruckt werden durfte, und die einzige zwischenzeitliche Ausgabe war 1964 auf Russisch von einem amerikanischen Verlag herausgegeben worden. Übersetzungen gab es noch gar nicht, die erste und für lange Zeit auch einzige erfolgte erst 1991 als "Il vascello folle" ins Italienische. Nun ist als zweite eine deutsche erschienen, unter dem Titel "Russisches Narrenschiff", und man darf sagen: Das neunzigjährige Warten hat sich gelohnt.
Das ist vor allem der Tatsache zu verdanken, dass Christiane Pöhlmann, Lesern dieser Zeitung bekannt als Literaturrezensentin, sich nicht aufs bloße Übersetzen beschränkt hat - was bei Forschs Sprachreichtum und Formbewusstsein schon anspruchsvoll genug gewesen wäre -, sondern den Romantext auch durch einen nicht ausufernden, aber gerade deshalb sehr hilfreichen Anmerkungsapparat ergänzt, vor allem aber dem "Narrenschiff" noch zwei Abschnitte beigegeben hat, die keck als "Lyrisches Gepäck" und "Passagiere der Narretei, auch Blinde, und die Crew" betitelt sind. Dieses Gepäck besteht aus einer kleinen Auswahl von Gedichten der russischen Avantgarde, die der Roman entweder selbst zitiert oder auf die er anspielt. Die Passagier- und Crewliste wiederum setzt sich zusammen aus Kurzbiographien von literarischen Akteuren der frühen Sowjetzeit, die im Roman unter ihren Klarnamen (selten), Pseudonymen (häufig) oder auch gar nicht explizit auftreten (deshalb "Blinde Passagiere"), aber für Olga Forsch eine wichtige Rolle gespielt haben.
Bevor man nun abgeschreckt werden könnte durch das Gefühl, sich auf der Grundlage eines gerade einmal zweihundertseitigen Romans ein ganzes Universum erschließen zu müssen, sei gesagt: Die Lektüre jedes der Zusatzteile ist kein geringeres Vergnügen als die des "Narrenschiffs" selbst, denn einfallsreicher und vor allem gefühlvoller gedichtet als im Russland des frühen zwanzigsten Jahrhunderts wurde in der westlichen Literatur nicht, und Pöhlmann beherrscht die große Kunst, mit knappsten Bemerkungen ganze Persönlichkeiten zu umreißen. Wer aus diesem "Russischen Narrenschiff" wieder herauskommt (und man wird es nur ungern wieder verlassen), der verspürt eine unbändige Trauer um die untergegangene, ja leider muss man sagen: größtenteils mörderisch vernichtete literarische Welt der russischen Avantgarde.
Olga Forsch überlebte den Stalinismus, indem sie sich anpasste. Und weil ihr Roman 1930 zu einem Zeitpunkt erschien, als sein wichtigster Schauplatz, das Haus der Künste in Petrograd, in dem die literarische Avantgarde für kurze Zeit ein staatlich geduldetes Forum gefunden hatte, schon seit 1923 wieder geschlossen war. So konnten nur noch Insider im "Narrenschiff" das Porträt dieser Epoche erkennen, aber natürlich reichte auch das, um den Roman danach in der Sowjetunion unmöglich zu machen - und seine 1873 geborene, also damals beinahe schon sechzigjährige Autorin fortan übervorsichtig. Als Forsch Anfang der dreißiger Jahre Nina Berberowa in deren Pariser Exil besuchte, brach sie den lang entbehrten Kontakt zu der Freundin aus alten Petrograder Tagen nach dem ersten Treffen wieder ab, weil ihr vom russischen Konsulat zu verstehen gegeben worden war, dass Berberowa und ihr Mann Wladislaw Chodassewitsch weiterhin als Feinde der Sowjetunion betrachtet wurden.
So überstand Forsch dann auch die Säuberungen der Folgejahre, schrieb erfolgreiche Historienromane und starb erst 1961. Ihren längst toten, bisweilen auch ermordeten jüngeren Weggefährten wie etwa Sergej Jessenin, Nikolaj Kljujew, Sergej Neldichin, Lew Lunz oder Nikolaj Gumiljow hat sie im "Narrenschiff" bewegende Denkmale gesetzt.
"Was soll das bloß für ein Roman sein?" Diese Frage wird vom "Narrenschiff" einem imaginierten Leser in den Mund gelegt: "Was für eine Gattung? Und, wenn die Frage erlaubt ist, an welchen Leser richtet er sich eigentlich?" Die Antwort auf die letzte Frage ist leicht zu geben: an alle, die Herz und Hirn gleichermaßen adressiert sehen wollen. Mit den anderen beiden Fragen verhält es sich schwieriger. Christiane Pöhlmann verwahrt sich gegen die Einordnung des von ihr übersetzten Textes als Schlüsselroman, denn er ziele "nicht auf Demaskierung, sondern verhandelt die eigene künstlerische Position oder Poetologie" - siehe eben die drei Fragen. Man könnte "Narrenschiff" eine Satire nennen, doch das würde nicht dem Ernst gerecht, der aus dem Pathos der Trauer spricht, die immer spürbarer wird. Forsch teilte ihr Buch in neun "Wellen" statt Kapiteln auf, anknüpfend an eine russische apokalyptische Tradition, und so wird denn im Roman auch alles immer schlimmer, aber zugleich literarisch immer besser, denn da schreibt eine Frau um ihr Leben - buchstäblich, denn sie riskierte mit der Liebeserklärung an eine verfemte Literatur mehr als nur die berufliche Existenz, und inhaltlich, denn Forsch bewahrt im "Narrenschiff" auf, was ehedem ihr Leben war und 1930 längst nicht mehr sein durfte.
Ähnlich risikoreich, nur vollkommen im Verborgenen gehalten, war zu Beginn der bolschewistischen Herrschaft das Schreiben des im selben Jahr wie Olga Forsch geborenen Michail Prischwin. Aus ihm wurde später einer der erfolgreichsten sowjetischen Schriftsteller, weil er sich publizistisch konsequent maskierte und seine Ablehnung des Systems nur in den seit 1905 geführten Tagebüchern festhielt. Schon im März 1919 notierte er: "Natürlich befinden wir uns in der Hand von Verbrechern, aber auf sie zeigen und sagen: ,Die da sind schuld!' können wir nicht, insgeheim fühlen wir, dass wir alle schuld sind, und deshalb sind wir machtlos, sind wir Gefangene." Solcher Einträge wegen verbarg er die Tagebücher sorgfältig, und so hielten es nach Prischwins Tod 1954 auch seine Witwe und dann deren Nachlassverwalter, die aber die zahllosen Hefte schon einmal transkribierten. Aber erst 1991 konnte eine russische Edition beginnen, die dann vor zwei Jahren mit Band 18 endlich abgeschlossen wurde: mehr als 12 000 Seiten mit unkaschierten Ansichten eines Intellektuellen in der Sowjetunion, dargeboten in einer Formenvielfalt, die von Alltagseindrücken über Traumnotate, Allegorien, Aphorismen bis zu regelrechten Reportagen reicht.
Aus dieser Fülle an Material hat Eveline Passet in den letzten Jahren eine Auswahl getroffen, sie ins Deutsche übersetzt und kommentiert. Vier Bände sollen daraus werden mit zusammen rund 1200 Seiten reinen Notaten, also einem runden Zehntel des Bestands. Nun ist der erste Teil erschienen, mit Tagebucheinträgen der Jahre 1917 bis 1920; natürlich kann man sich gar keine interessantere Zeit in der russischen Geschichte denken als die der beiden Revolutionen von 1917, des Bürgerkriegs und der beginnenden Etablierung des kommunistischen Systems. Es waren zugleich jene Jahre, in denen sich der literarische Kreis, den Olga Forsch im "Narrenschiff" beschreibt, in Petrograd zusammenfand, wo Prischwin in den Wintern lebte, während er im Sommer das Familiengut im südlich von Moskau gelegenen Städtchen Jelez bewirtschaftete.
Es gab indes selten unmittelbare Berührungspunkte von Prischwins Umkreis mit jenen Dichtern, die das Personal von Froschs Roman bilden: Andrej Bely und Alexander Blok spielen etwa in beiden Büchern eine Rolle, bei Prischwin indes nur vermittelt durch ihre publizistische Wirkung. Prischwin selbst scheute in den ersten Jahren nach der Oktoberrevolution die Teilnahme am intellektuellen Leben, um sich nicht im Gespräch zu diskreditieren, veröffentlichte fast gar nicht mehr und gab bald auch seinen Wohnsitz in Petrograd zugunsten von Moskau auf. Wie er sich durch die Schrecken des Bürgerkriegs, durch Hunger, Bespitzelung und Verrat bewegte, einmal sogar als bürgerliche Geisel in Haft kam und im Jahr 1919 drei Geschwister verlor, das macht seine Tagebücher zu einer Geschichte, die man sich nicht träumen lassen möchte. Es ist das scheinbar noch phantastischere dieser beiden Bücher, etwa in Passagen wie dieser vom Januar 1920: "Wir hatten damit gerechnet, in diesem Winter vor Hunger und Kälte zu sterben, aber es gab mehr Mehl als im vorigen Jahr, auch an Holz mangelt es nicht allzu sehr, dafür aber hat sich der geistige Hunger derart ausgewachsen, dass wir an ihm sterben."
Michail Prischwin sättigte diesen Hunger in der Manier eines Baron Münchhausen: indem er sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf zog, also selbst scharfsinnig schrieb, wo ihn sonst keine Literatur mehr inspirierte. Ein Tagebucheintrag vom Juli 1917, also zwischen den beiden Revolutionen jenes Jahres notiert, ist in Metaphorik und gedanklicher Tiefe eine Vorwegnahme von Benjamins "Thesen über den Begriff von Geschichte", nur deftiger formuliert: "Das Gesicht der Revolution hat niemand gesehen, denn niemand kann ihr vorauseilen. Diejenigen, die mit ihr dahinjagen, können nichts über sie sagen. Aber auch diejenigen, an denen sie vorbeistürmt, sehen nichts: Staub, Schutt, und allerlei aufgewirbelter Plunder verhüllen ihnen das Licht. Natürlich ist die Revolution ein halb menschliches, halb tierisches Wesen. Und diejenigen, die nicht mit ihr dahinjagen, sehen nur das riesige, Unreinheit zurücklassende Hinterteil des Tiers."
ANDREAS PLATTHAUS
Olga Forsch: "Russisches Narrenschiff". Roman.
Aus dem Russischen, mit Anmerkungen und Nachwort von Christiane Pöhlmann. Die Andere Bibliothek, Berlin 2020. 323 S., geb., 44,- [Euro].
Michail Prischwin: "Tagebücher". Band 1: 1917 bis 1920.
Hrsg. und aus dem Russischen von Eveline Passet. Guggolz Verlag, Berlin 2019. 460 S., 2 Abb., geb., 34,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main