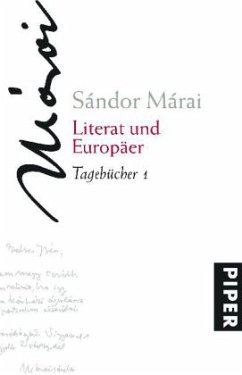Als junger Mann verlässt Sándor Márai (1900 1989) Ungarn, um Europa zu entdecken. Er geht nach Deutschland und Frankreich, arbeitet als Essayist und Kritiker in Leipzig, Frankfurt und Berlin, er sieht Paris, bevor er Ende der Zwanzigerjahre mit seiner Frau nach Ungarn zurückkehrt. Als er 1943 beginnt, sich Notizen zu machen, regelmäßiger erfüllte Augenblicke und Erinnerungen an seine Jugend einem Tagebuch anzuvertrauen, ist er längst einer der einflussreichsten Autoren seiner Heimat. Immer intensiver wird neben der Literatur und seinen Leseeindrücken die Beschäftigung mit aktuellen Ereignissen, mit der Belagerung, die Budapest droht. Immer schärfer formuliert er seine politischen Gedanken. Es ist das eindrucksvolle Porträt des Menschen und Europäers Sándor Márai, das uns aus seinen Tagebüchern entgegentritt.

Zeitgeschichte und Kommentar: In den ersten beiden Bänden der Tagebücher von Sándor Márai, die jetzt auf Deutsch vorliegen, erklingt der polyphone Echoraum eines Unbeugsamen.
Sándor Márais zweiter Tagebucheintrag gilt einem aufgebahrten Toten. "Er lag so einsam da, so schmucklos, so bar jeder Festlichkeit ... Er starb, wurde in einen Sarg gelegt, mitten in der Kirche abgelegt. Der Küster würde ihn am Morgen schon finden." Márai durchstreift Pistoia, ein toskanisches Städtchen, alle Sinne geöffnet und zu Vergleichen aufgelegt, als schreibe er an einem Roman. "Die Luft war schwer mit dem schwülen Duft von Lorbeer und Mimose, dem Geruch der Regenwolken, als trocknete feuchte, schlampig gewaschene, graue Unterwäsche in den Höhen." Ziellos betritt er die Kirche, wo der Tote liegt. Kein Klagegeschrei, kein Weihrauch, nichts, was den Anblick stört. Er kann seinen Blick ungehemmt umherwandern lassen, wahrscheinlich könnte er sich sogar Notizen machen. Und auch wenig später bei der Beerdigung eines Bekannten ist ihm danach: "Ich würde am liebsten alles fotografieren und notieren, die Zimmereinrichtung, die Beleuchtung, das Gesicht des Toten." Der Ruf nach der Feder gerade in erschütternden Momenten mag ein sicheres Zeichen sein: Hier schaut, sammelt, ordnet ein Schriftsteller die Welt, der nicht anders kann als schreiben, "auch dann, ja gerade dann, wenn die Welt am Einstürzen ist".
Die Form des Tagebuchs ist Márai allerdings neu, als er 1943, mit 43 Jahren, damit beginnt, ein Jahr nachdem sein Roman "Die Glut" erscheint, geprägt noch von der Lektüre des Tagebuchs von Jules Renard, gebannt von der eigenen Ahnung: "Die Literatur hat auch ein unsichtbares Leben; und dieses ist vielleicht das wirklichere." In Ungarn ist er zu diesem Zeitpunkt beispiellos populär, mit Romanen, Dramen und als Journalist präsent, als welcher er viel früher übrigens auch lange in Deutschland für die "Frankfurter Zeitung" schrieb. Jetzt, in Zeiten einer gesteuerten Presse, bricht er konsequent mit dem feuilletonistischen Schreiben. Auch folgende Romane publiziert er vorerst nicht. Doch das Tagebuch-Schreiben wird ihm begleitendes Handwerk, von dem er bis zu seinem Freitod 1989 im Exil, dem kalifornischen San Diego, nicht mehr lässt. Geschätzte siebzehn Bände sollen einmal alle seine Notizen füllen. Vereinzelt erschienen auch hierzulande bereits Auszüge, unter anderem zwei Bände im Oberbaum Verlag. Eine "ungekürzte und sorgfältig überprüfte" Edition stand noch aus. Diese startete 2006 der ungarische Helikon-Verlag, nachdem Márais Nachlass, der bis 1997 in Toronto beim ungarischen Verlag Vörösváry Publishing Company lagerte, nach Budapest ins Petöfi-Literaturmuseum wechselte. Für deutsche Leser gibt der Piper Verlag diese gigantische Edition heraus. Der Anfang ist mit zwei Bänden der Jahre 1943/44 und 1945 nun gemacht.
Der hier schreibt, ist ein zunehmend gegenüber Ungarn Verbitterter. 1920 war Márais Heimat, Kaschau in Oberungarn, an die Tschechoslowakei angeschlossen worden und Márai ungewollt ein Verbannter. In den vierziger Jahren folgten deutsche, dann russische Okkupation. Aber ganz gleich, welche Fremdmächte gerade wirkten - immer richtet Márai seinen gründlichen Blick reflektierend nach innen, ins Herz des eigenen Volkes, ins einzelne Subjekt. Gnadenlos hoch ist sein Anspruch an die Ungarn, an deren "geistiges Selbstgefühl" er immer weniger glaubt. Und selbst wen Details der ungarischen Geschichte nicht interessieren, dürfte bewegt sein von dieser ständigen inneren Auseinandersetzung um Eigenverantwortung. Für sich selbst hat Márai schon früh eine Unabhängigkeit beschlossen, die sein Überleben sichert, zugleich aber geradewegs in die Einsamkeit seiner allerletzten Jahre zu führen scheint: "Meine einzige Waffe gegen die Welt: Ich erwarte nichts von ihr."
Zunächst sind diese Tagebücher deshalb Zeitgeschichte und Kommentar. Márai versteht sich dabei keineswegs als Chronist, dem genaue zeitliche Zuordnungen wichtig wären. Daten fehlen. Erinnerungen an erste Lieben durchbrechen Beschreibungen des Alltags. Das Tagebuch dient nicht täglicher Selbstvergewisserung, sondern bietet Márai einen jederzeit verfügbaren Echoraum, wenn ebenbürtige Gesprächspartner ihm fehlen. Er füllt es stilvoll mit perlenden Aphorismen und Atmosphäre, mit einer späteren Veröffentlichung durchaus liebäugelnd. Aus Verantwortungsgefühl gab er noch 1945 den ersten, gestutzten Band selbst heraus - zu Recht, denn er liefert nicht nur Stimmungsbilder, sondern pflegt vor allem anderen ein bekennendes Selbstgespräch, nie allzu privat, keineswegs weitschweifig, dafür hellsichtig, treffsicher, nur manchmal arg verallgemeinernd. Er ringt um Werte wie Maß und Haltung, eher Europäer und ganz "Bürger" in einem tieferen Sinn, Vertreter einer vom Aussterben bedrohten Art in einem immer faschistischer werdenden Land. Literatur liest der adlige Anwaltssohn, der mehrere Sprachen beherrscht, ganz selbstverständlich im Original - Goethe, Shakespeare, Kafka, Homer, Ikonen der Weltliteratur in katastrophischen Zeiten. Pflichterfüllung, "der Amoklauf durch die Arbeit", ist ihm oft die einzige Rettung. Mit Wissen kontert er den Untergang. Übertreibung und Überschwang sind ihm ebenso suspekt wie eine "übertriebene Sympathie". Diese Strenge mit sich selbst und anderen, dieses "Wissen, dass niemand einem hilft", zu dem er sich immer wieder selbst ermahnt, zieht sich wie ein roter Faden durch die ersten Tagebuchjahre, in denen er immer präziser beobachtet. Keineswegs aber wirken diese beständig nach Orientierung suchenden Notizen nur distanziert oder verbittert. Márai vermag es auch, Begeisterung mitzuteilen, ohne pathetisch zu klingen. "Ein Vulkan bedeutet mir nichts. Ein Mensch alles."
Und doch dringen viele seiner Beobachtungen in dieser Kriegszeit aus dem "Treibhaus der Unterwelt". "Als wäre am neunzehnten März etwas in mir zerbrochen", notiert er über den Einmarsch der Deutschen 1944. Mit seiner Frau, die Jüdin ist, zieht er von Budapest aufs Land und untersagt die Veröffentlichung seiner Schriften. Die Stadtwohnung wird zerbombt. Im Dorf quartiert sich die sowjetische Armee bei ihm ein, die er so eingehend studiert wie sein eigenes Volk, an dem er kaum mehr Qualitäten findet: 1948 entschließt sich das Paar, mit dem Adoptivsohn János Ungarn für immer zu verlassen. An János - ein leiblicher Sohn starb bereits früh - entzünden sich Márais intimste Eintragungen, sein stilles Glück und die Angst davor, zu viel Liebe zu geben. Und mag man anderen Notaten ihre krasse Urteilsschärfe vorhalten, versöhnen einen Einsichten wie diese: "Der Schriftsteller wird inmitten der Abenteuer des Lebens langsam wie Cyrano: Er ist sein eigener Souffleur." Das Tagebuch ist Ausdruck dieser beständigen Zurede, Produkt eines fortwährenden Schreckens, gegen den Márai anformuliert: "Überleben kann man das alles nicht; doch überschreiben? ... Versuch es." Diese Bände gehören neben Julien Green, Virginia Woolf und viele andere manische Jahrhundert-Überschreiber gestellt. Nicht allein wegen des zeitgeschichtlichen Gehalts, sondern aufgrund ihrer stilisierten Wahrhaftigkeit.
Als Márai den Toten in der Kirche von Pistoia ungestört und lange betrachtet, wendet sich etwas in ihm. "Da begriff ich zum ersten Mal, dass der Tod nichts Schreckliches, sondern Gleichgültigkeit ist. Und auch eine Art Fest, bei dem man sich schwarz kleidet. Wenn er stirbt, wird jeder zum Armen und kleidet sich schwarz." Er ist 89 Jahre alt, als er sich in San Diego im Schießen unterweisen lässt. Am Sonntag vor zwanzig Jahren, dem 22. Februar 1989, beendet er, nachdem er seine kranke Frau bis zum Tod gepflegt hat, sein Leben von eigener Hand.
ANJA HIRSCH
Sándor Márai: "Literat und Europäer". Tagebücher 1. 1943-1944. Aus dem Ungarischen von Akos Doma. Mit einem Vorwort von Lázló F. Földényi. Herausgegeben, mit Anmerkungen und einem Nachwort von Ernö Zeltner. Piper Verlag, München 2009. 472 S., geb., 39,90 [Euro].
Sándor Márai: " Unzeitgemäße Gedanken". Tagebücher 2. 1945. Aus dem Ungarischen von Clemens Prinz. Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Ernö Zeltner. Piper Verlag, München 2009. 436 S., geb., 39,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Beim Lesen dieser ersten beiden Tagebuchbände von Sandor Marai kommt es Anja Hirsch mitunter vor, als wohne sie der Entstehung eines Romans bei. Neben Marais' sinnlicher Aufnahmefähigkeit imponieren ihr seine Urteilsschärfe und sein gründlicher, weniger auf Privates, denn auf innere Vorgänge (des Volkes, des Subjekts) gerichteter Blick. Hirsch liest die Einträge als zeitgeschichtliche Dokumente, als beständige kritische Auseinandersetzung des Autors mit seiner Heimat Ungarn, aber auch als hellsichtigen, treffsicheren Kommentar, der durch Marais Ausdruck zu "stilisierter Wahrhaftigkeit" wird. Die Befürchtung, hier auf die allzu distanzierte, verbitterte Stimme eines Zurückgezogenen zu stoßen, möchte Hirsch dem Leser gerne nehmen. Obwohl der Autor jedem Überschwang entsagt, wie es heißt, stößt die Rezensentin immer wieder auch auf Momente der Begeisterung. Nach ihrem Ermessen haben diese Bände ihren Platz neben großen Tagebuchschreibern wie Julian Green und Virginia Woolf.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH