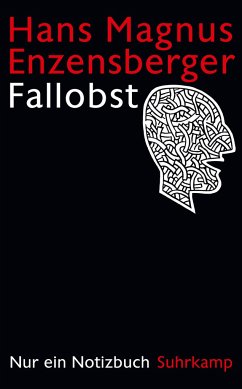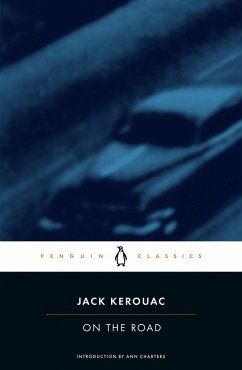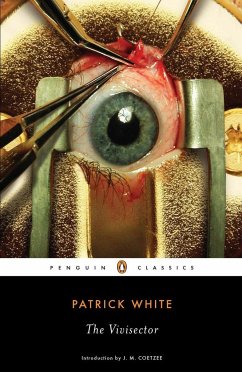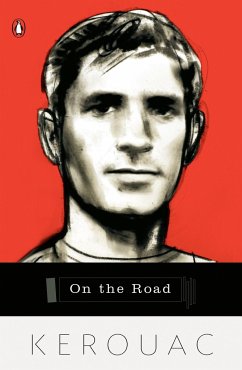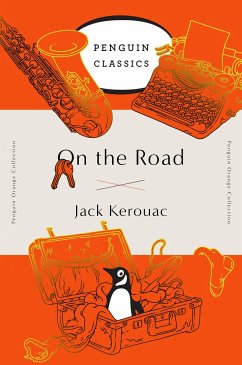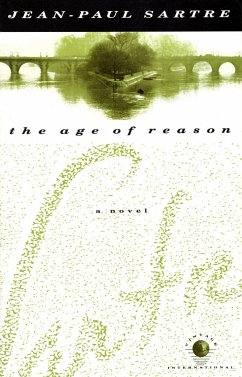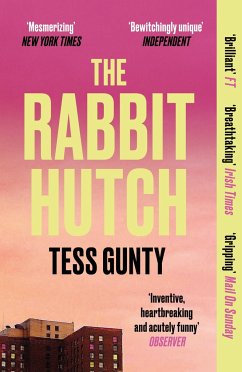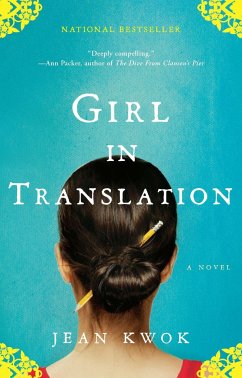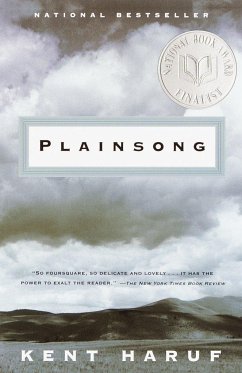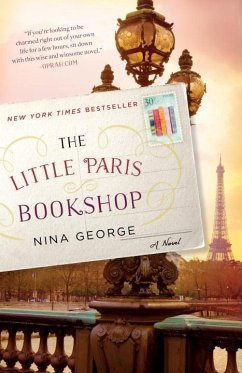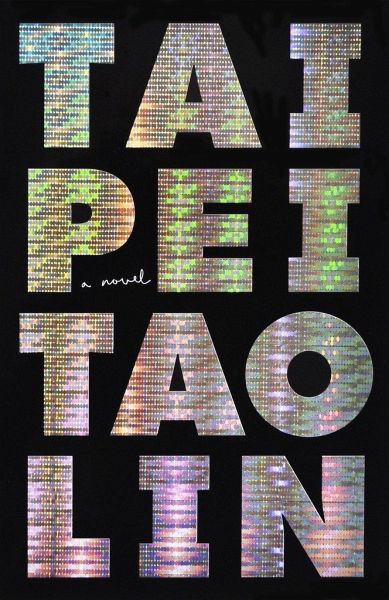
Taipei
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
17,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
9 °P sammeln!
The basis for the movie High Resolution From one of this generation's most talked about and enigmatic writers comes a deeply personal, powerful, and moving novel about family, relationships, accelerating drug use, and the lingering possibility of death. Taipei by Tao Lin is an ode--or lament--to the way we live now. Following Paul from New York, where he comically navigates Manhattan's art and literary scenes, to Taipei, Taiwan, where he confronts his family's roots, we see one relationship fail, while another is born on the internet and blooms into an unexpected wedding in Las Vegas. Along th...
The basis for the movie High Resolution From one of this generation's most talked about and enigmatic writers comes a deeply personal, powerful, and moving novel about family, relationships, accelerating drug use, and the lingering possibility of death. Taipei by Tao Lin is an ode--or lament--to the way we live now. Following Paul from New York, where he comically navigates Manhattan's art and literary scenes, to Taipei, Taiwan, where he confronts his family's roots, we see one relationship fail, while another is born on the internet and blooms into an unexpected wedding in Las Vegas. Along the way-whether on all night drives up the East Coast, shoplifting excursions in the South, book readings on the West Coast, or ill advised grocery runs in Ohio-movies are made with laptop cameras, massive amounts of drugs are ingested, and two young lovers come to learn what it means to share themselves completely. The result is a suspenseful meditation on memory, love, and what it means to be alive, young, and on the fringe in America, or anywhere else for that matter.