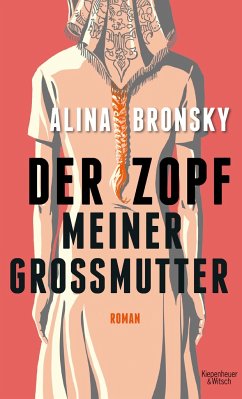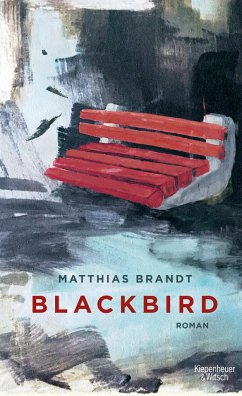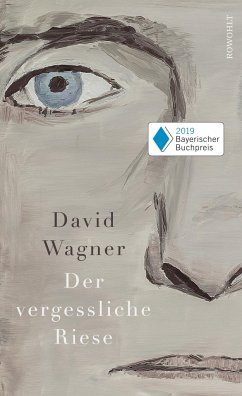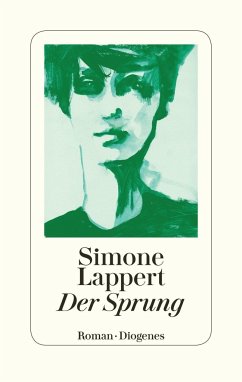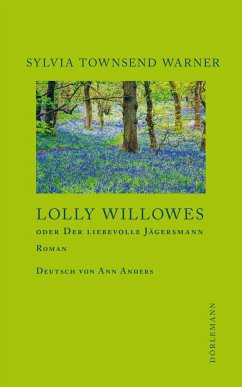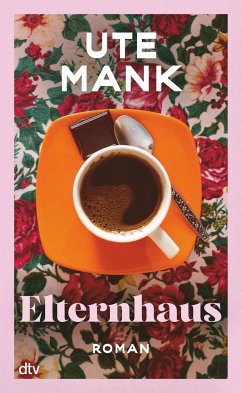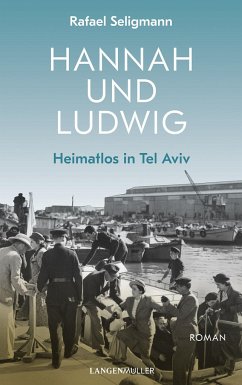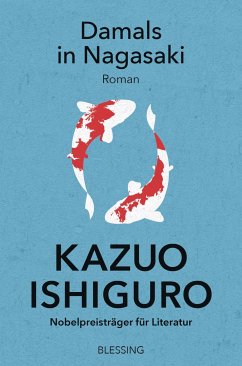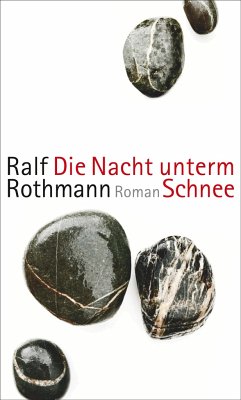Nicht lieferbar
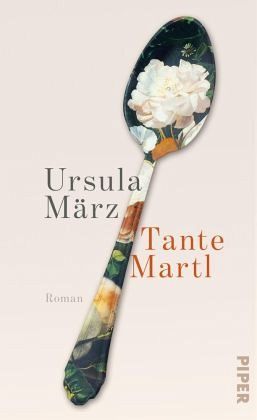
Tante Martl
Roman
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Tante Martl ist scheinbar unscheinbar, in Wahrheit aber ganz besonders. Der Leser spürt es gleich an der Art, wie sie ihre Telefonanrufe eröffnet: mit einem Stöhnen, dem ein unerwarteter Satz folgt. Geboren als dritte Tochter eines Vaters, der nur Söhne wollte, ist Martl die ungeliebte Jüngste, die keinen Mann findet, dafür aber einen Beruf als Volksschullehrerin. Nie verlässt sie die westpfälzische Kleinstadt, in der sie geboren wurde, ja nicht einmal ihr Elternhaus. Und obwohl sie ihren Vater jahrelang pflegt, während ihre Schwestern Familien gründen, bewahrt sie ihre Selbstständi...
Tante Martl ist scheinbar unscheinbar, in Wahrheit aber ganz besonders. Der Leser spürt es gleich an der Art, wie sie ihre Telefonanrufe eröffnet: mit einem Stöhnen, dem ein unerwarteter Satz folgt. Geboren als dritte Tochter eines Vaters, der nur Söhne wollte, ist Martl die ungeliebte Jüngste, die keinen Mann findet, dafür aber einen Beruf als Volksschullehrerin. Nie verlässt sie die westpfälzische Kleinstadt, in der sie geboren wurde, ja nicht einmal ihr Elternhaus. Und obwohl sie ihren Vater jahrelang pflegt, während ihre Schwestern Familien gründen, bewahrt sie ihre Selbstständigkeit. Wie Tante Martl das schafft und in hohem Alter noch einen großen Fernsehauftritt bekommt, erzählt Ursula März mit staunender Empathie und widerständigem Humor.





 buecher-magazin.deTante Martl ist die Tante und Patin der Literaturkritikerin Ursula März. Tante Martl ist eine, die anruft und ins Telefon stöhnt, weil „de dumm Lackaff“ Gottschalk am Abend vorher wieder „Wetten dass …?“ moderiert hat, eine, die ein Butterbrot eine „redlisch Mahlzeit“ nennt. Tante Martl, geboren 1925 im westpfälzischen Zweibrücken, war Lehrerin, gebildet, niemals verheiratet und blieb kinderlos. Sie besaß, im Gegensatz zu ihren beiden Schwestern, schon in den Fünfzigerjahren ein Bankkonto und Auto. Ihre Gefühle zum eigentlichen Kindheitstrauma holen sie erst im Altersheim ein. Der Vater hatte auf dem Standesamt zunächst den Namen Martin angegeben, aus Enttäuschung über das Geschlecht seines dritten Kindes. Facettenreich erzählt Ursula März von der tragischen Komik dieser Episode und wie Martl, nach Jahren der Leugnung ihres Leides, das sie durch die Ablehnung des Vaters erfuhr, doch noch schimpft: „Die habbe e Bub aus mir gemacht!“ Tante Martl ist eine zärtliche und gleichzeitig augenöffnende Hommage an eine Frau, die für ihre Zeit zu selbstständig war, um sich einzufügen, die Stil und Abenteuerlust besaß und sich dennoch nie von ihrem provinziellen, patriarchalischen Elternhaus lösen konnte. Die den Vater noch pflegt, der ihr seine Liebe vorenthielt.
buecher-magazin.deTante Martl ist die Tante und Patin der Literaturkritikerin Ursula März. Tante Martl ist eine, die anruft und ins Telefon stöhnt, weil „de dumm Lackaff“ Gottschalk am Abend vorher wieder „Wetten dass …?“ moderiert hat, eine, die ein Butterbrot eine „redlisch Mahlzeit“ nennt. Tante Martl, geboren 1925 im westpfälzischen Zweibrücken, war Lehrerin, gebildet, niemals verheiratet und blieb kinderlos. Sie besaß, im Gegensatz zu ihren beiden Schwestern, schon in den Fünfzigerjahren ein Bankkonto und Auto. Ihre Gefühle zum eigentlichen Kindheitstrauma holen sie erst im Altersheim ein. Der Vater hatte auf dem Standesamt zunächst den Namen Martin angegeben, aus Enttäuschung über das Geschlecht seines dritten Kindes. Facettenreich erzählt Ursula März von der tragischen Komik dieser Episode und wie Martl, nach Jahren der Leugnung ihres Leides, das sie durch die Ablehnung des Vaters erfuhr, doch noch schimpft: „Die habbe e Bub aus mir gemacht!“ Tante Martl ist eine zärtliche und gleichzeitig augenöffnende Hommage an eine Frau, die für ihre Zeit zu selbstständig war, um sich einzufügen, die Stil und Abenteuerlust besaß und sich dennoch nie von ihrem provinziellen, patriarchalischen Elternhaus lösen konnte. Die den Vater noch pflegt, der ihr seine Liebe vorenthielt.