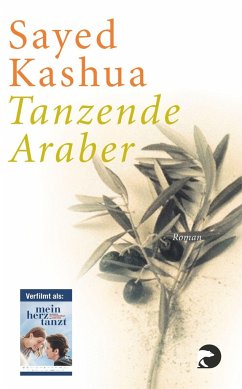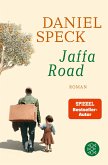Aufgewachsen ist er in dem arabischen Dorf Tira, mit der Legende seines 1948 ums Leben gekommenen Großvaters und einem ehrgeizigen Vater, der in seiner Jugend die Universitätscafeteria in die Luft gejagt und dafür zwei Jahre im Gefängnis gesessen hat und nun hofft, dass sein Sohn Pilot wird oder zumindest der erste Araber, der eine Atombombe baut. Der Sohn stellt sich allerdings als »Feigling« heraus, genau wie seine Brüder: »Mein Vater versteht nicht, warum ich und meine Brüder so geworden sind. Wir können nicht einmal eine Fahne zeichnen. Er sagt, dass andere Kinder - manche sind sogar jünger als wir - durch die Straße marschieren und dabei »PLO - Israel NO« singen, und dann wirft er mir vor, dass ich wahrscheinlich nicht einmal weiß, was PLO heißt.« Der Erzähler flüchtet sich hinter eine Vielzahl von Masken und muss doch verzweifeln an dem unauflösbaren Konflikt der Identitätsfindung - weder in der arabischen noch in der jüdischen Welt findet er eine innere Heimat. Ein mutiges und hellsichtiges Buch, dessen sanfte Selbstironie und melancholischer Witz überraschen.

Selbstquälerisch: Das Erstlingswerk eines israelischen Arabers
Der Autor dieses Buchs muß ein sehr unglücklicher Mann sein, oder aber er ist ein Meister der Verstellungen und Masken. Er kann sich so gründlich verstellen, daß wir ihn selbst dann, wenn wir annehmen, er verstellte sich, für einen unglücklichen Mann halten müssen. Nicht einmal das Pressefoto, auf dem er mit breitem Lächeln direkt in die Kamera blickt, vermag unseren Glauben an das Unglück des Verfassers zu ändern. Während der Lektüre wohnt man einer erzählerischen Selbstverstümmelung bei, wird Zeuge eines literarischen Flagellantentums, das seinen Reiz durchaus haben könnte, wenn es sich nur des passenden Werkzeugs bediente. Einmal wagt es Sayed Kashua, Jahrgang 1975, Thomas Bernhard in seinen Text zu schmuggeln. Während der Antiheld im Krankenhaus auf die Entbindung seiner Frau wartet, nimmt er wie üblich, um nicht für den Araber gehalten zu werden, der er ist, ein hebräisches Buch zur Hand. "Es ist nicht irgendein Buch, sondern ,Wittgensteins Neffe'. Sogar ein Arzt würde staunen, wenn er zufällig vorbeikäme."
Der Rezensent auch. Der große Unterschied zwischen Bernhard und Sayed Kashua - einmal abgesehen von den vielen kleinen und mittleren - liegt im Stil. Hätte man nicht bei zahlreichen anderen israelischen Schriftstellern gelesen, was im Hebräischen möglich ist, man müßte glauben, in dieser Sprache seien Nebensätze verpönt. Doch wir lesen zur Sicherheit noch einmal Yoram Kaniuk und wissen, daß es nicht so ist. Noch drei andere Schriftsteller werden dann neben Thomas Bernhard genannt: Amos Oz, der palästinensische Dichter Mahmud Darwish und der arabisch-israelische Schriftsteller und Israel-Preisträger Emil Habibi. Die Abstammung von den Woody-Allen-Typen, die einem bei Oz und Habibi begegnen, liegt bei Sayed Kashuas namenlosem Erzähler auf der Hand. Aber eine entscheidende Eigenschaft der Romanfiguren seiner Vorbilder teilt er nicht, nämlich ihren oft jungenhaften Charme zwischen Don Quichotte und Prophet.
Und noch ein Unterschied ist zu nennen, vielleicht der entscheidende: Während Oz als jüdischer Israeli auf hebräisch schreibt und Habibi als arabischer Israeli auf arabisch, schreibt Kashua als arabischer Israeli auf hebräisch. Zwar gibt es Araber, die auf hebräisch schreiben, nämlich die arabischen, aus arabischen Ländern nach Israel eingewanderten Juden (etwa Sami Michael), aber es gibt keinen international bekannten Romanautor, der von Geburt Muslim ist und auf hebräisch schreibt. Sayed Kashua besetzt also eine Leerstelle, situiert sein Schreiben in einer neuen, spannenden Konstellation. Doch im gleichen Atemzug, in dem das Buch die Leerstelle besetzt, verrät es uns (ob freiwillig oder nicht, sei dahingestellt), warum diese Leerstelle bislang eine Leerstelle war. Und warum Kashua an seinem Platz so bald keine Konkurrenz fürchten dürfte.
Von den Arabern in Israel wissen wir in der Regel wenig mehr, als daß es sie gibt. Es sind die Nachkommen derjenigen Palästinenser, die im arabisch-israelischen Krieg von 1948 nicht aus Palästina geflohen oder die rechtzeitig wieder zurückgekehrt sind, also die nicht jüdischen, sondern entweder christlichen oder muslimischen Einwohner Palästinas. Sie machen derzeit etwa ein Sechstel der israelischen Bevölkerung aus, mit steigender Tendenz. Sie gelten als israelische Staatsbürger, haben jedoch andere Pässe als die israelischen Juden und müssen nicht zum Militärdienst, was letztlich auf eine Diskriminierung hinausläuft, denn manche Studiengänge, wie etwa Medizin, sind ohne vorherigen Militärdienst kaum zugänglich.
Die Loyalitäten der israelischen Araber im Nahost-Konflikt sind unklar. Viele Israelis trauen ihnen nicht. Glaubt man Sayed Kashua, so haben sie sogar recht. Ein großer Teil der Problematik dieses Buchs liegt darin, daß der Autor nicht nur seinen Helden, sondern einen ganzen, ohnedies unter beträchtlichem Diskriminierungsdruck stehenden Bevölkerungsteil der Lächerlichkeit preisgibt.
Mit sicherlich starkem autobiographischem Einschlag schildert Kashua die Jugend eines solchen israelischen Arabers. Der Junge, aus dessen Perspektive rückblickend erzählt wird, ist von Anbeginn als Verlierer und Antiheld angelegt, der sich bei der Großmutter wohler fühlt als bei den Eltern und ein großer Angsthase ist. Er versucht, sich dem Einfluß des Vaters zu entziehen, der eine Karriere als palästinensischer Extremist hinter sich hat, seinen Sohn indoktrinieren will und ständig Gefahr läuft, erneut verhaftet zu werden. Dennoch ist der Vater stolz, als es dem Sohn gelingt, unter tausend arabischen Bewerbern einen Platz in einem israelischen Eliteinternat zu ergattern. Hier fühlt sich der Junge noch fremder, aber er versucht mit Erfolg, sich den Juden soweit wie möglich anzupassen und akzentfrei hebräisch zu sprechen.
Die Erzählung über einen Araber in einem israelischen Internat könnte nahezu alle Facetten der besonderen Situation der israelischen Araber zur Sprache bringen. Hätte Kashua seinen Helden mit einem Bruchteil der seelischen Tiefe von Musils Törleß versehen, wir läsen ein aufwühlendes Zeugnis der Orientierungslosigkeit arabischer Bürger in Israel. Doch Kashua verleiht seinem Helden kein Bewußtsein, keine Seele, keine Sprache. Auch einen Narren, einen Schelm oder wenigstens einen ausgewachsenen Trottel will er uns nicht bieten. Nichts von dem, was das Buch über die Verrenkungen der israelischen Araber mutmaßlich sagen will, wird wirklich zur Sprache gebracht. Der Leser, so mag sich der Autor gedacht haben, geht ja ohnedies davon aus, daß die israelischen Araber entweder Extremisten sind oder orientierungslos und depressiv. Nur will es auch nicht gelingen, die Bemühungen des Helden, ein guter, angepaßter israelischer Araber zu werden, als sanfte Selbstironie zu lesen. Nirgendwo im Text gibt es ein Signal, das er erlauben würde, die permanente Selbstentblößung des Erzählers nicht ernst zu nehmen. Zumal der Verlag über den Autor genau die biographischen Details mitteilt, die auch den Romanhelden auszeichnen, einschließlich des genauen Wohnortes. Was ein echtes Klischee ist, was ironisches Zitat des Klischees, ist nicht mehr zu unterscheiden, zumal das negative Klischee über die Araber das bevorzugte Mittel des Helden ist, seinen Selbsthaß zu pflegen.
Die einzigen positiven arabischen Figuren des Buchs sind Frauen, die Großmutter und die Frau des Erzählers vor allem. Die Männer sind Terroristen wie der Vater, sie geben ihren Kindern die Namen russischer, gegen Israel gerichteter Raketen, sie jubeln den irakischen Scuds im Golfkrieg zu, sie glauben, auch wenn sie das Eliteinternat absolviert haben, mit Inbrunst an die einfältigsten Jenseitsvorstellungen. Ironie, falls dies alles denn wirklich ironisch gemeint ist, erweist sich als zu hohe Kunst für den schriftstellerischen Anfänger Sayed Kashua. Selbst der Buchtitel leidet unter der mißratenen Ironie.
Kashua wagt im übrigen das Experiment, sein Buch, das auch erst in diesem Jahr erschienen ist, bis an die jüngste Gegenwart heranzuführen. Während die Al-Aqsa-Intifada tobt, zieht der Erzähler, jetzt mit Frau und Kind, aber ohne berufliche Perspektive, in den palästinensischen Teil eines Dorfes bei Jerusalem, trotz der damit verbundenen Schikanen. Die Eltern und die Frau wollen, daß die junge Familie in das Heimatdorf im israelischen Kernland zurückzieht. Doch sie bleiben. Die israelischen Araber, so scheint Sayed Kashua sagen zu wollen, müssen sich für eine Partei entscheiden. Während sich der zerquälte Held für die Palästinenser entscheidet, indem er in den Autonomiegebieten lebt, entscheidet sich der Autor für Israel, indem er auf hebräisch schreibt. Was immer wir daraus schließen: Für die Literatur haben sich beide nicht entschieden.
STEFAN WEIDNER
Sayed Kashua: "Tanzende Araber". Roman. Aus dem Hebräischen übersetzt von Mirjam Pressler. Berlin Verlag, Berlin 2002. 279 S., geb., 19,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Seit seinem autobiografischen Debütroman 'Tanzende Araber' gilt Sayed Kashua als starke Stimme der jungen palästinensischen Generation. Kashua schreibt auf Hebräisch - und mit reichlich Selbstironie.« Jan Ludwig MERIAN 20160101