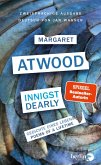Ausgezeichnet mit dem LYRIKPREIS MERAN
Wie erkennt man die wunden Punkte im Leben? »Taupunkt« führt fort und beschließt, was mit Kerstin Preiwuß' Gedichtband »Rede« begann und in »Gespür für Licht« seinen Lauf nahm: Für die Dauer einer Nacht setzt der Tonstrom ein. Unerschrocken dringt er durch die Schichten des Ichs. Dort setzt das Dichten an und sucht Zusammenhang. So weist »Taupunkt« immer in zwei Richtungen, bezeichnet den Schwellenwert, an dem Zustände sich trennen, und führt Fühlen und Wissen zusammen, ist Messkategorie und Metapher. Es ist Kunst, das Hin und Her des Lebens als Einheit zu begreifen und für dessen Widersprüchlichkeit offen zu sein.
»Ein lyrisches Sprechen, das von individueller Erfahrungstiefe gesattigt erscheint und sie doch diskret umschlagen lasst in etwas, das alle Leser anspricht.« Beate Tröger, Literaturblatt.de
Wie erkennt man die wunden Punkte im Leben? »Taupunkt« führt fort und beschließt, was mit Kerstin Preiwuß' Gedichtband »Rede« begann und in »Gespür für Licht« seinen Lauf nahm: Für die Dauer einer Nacht setzt der Tonstrom ein. Unerschrocken dringt er durch die Schichten des Ichs. Dort setzt das Dichten an und sucht Zusammenhang. So weist »Taupunkt« immer in zwei Richtungen, bezeichnet den Schwellenwert, an dem Zustände sich trennen, und führt Fühlen und Wissen zusammen, ist Messkategorie und Metapher. Es ist Kunst, das Hin und Her des Lebens als Einheit zu begreifen und für dessen Widersprüchlichkeit offen zu sein.
»Ein lyrisches Sprechen, das von individueller Erfahrungstiefe gesattigt erscheint und sie doch diskret umschlagen lasst in etwas, das alle Leser anspricht.« Beate Tröger, Literaturblatt.de
»Preiwuß (entwickelt) in verwirrend rätselhaften und klangmagisch aufregenden Gedichten geheimnisvolle Schöpfungsgeschichten, Fantasien von Verwandlungen und von Aufenthalten in einem Zwischenreich von menschlichem, tierischem und p anzlichem Dasein. In seinem naturmystischen Eigensinn ragt dieser Gedichtband heraus aus den lyrischen Neuerscheinungen dieses bleiernen Krisenjahres.« Zeit Online 20200620

Der Lyrikband "Taupunkt" von Kerstin Preiwuß
"Taupunkt", das vierte Gedichtbuch der Leipziger Autorin Kerstin Preiwuß, überrascht durch den Verzicht auf einige Üblichkeiten der lyrischen Praxis: Es spart sich die Gattungsbezeichnung "Gedichte", die Überschriften über den einzelnen Texten und - merkwürdig genug - das Inhaltsverzeichnis des Bandes. Aber natürlich gibt es kein Buch ohne einen Haupttitel. Er ist schön und zugleich rätselhaft, gut für Liebhaber von Lyrik - eben "Taupunkt".
Er klingt wie eine poetische Metapher, ist aber ein physikalischer Begriff, nämlich die Temperatur, bei der in einem Gas-Dampf-Gemisch das Gas mit dem Dampf gerade gesättigt ist. Das Titelgedicht findet sich - mittig abgesetzt - genau im Zentrum des Buches und geht so: "Der Taupunkt ist grausam / und er ist schlicht. / Man sieht ihn nicht / aber empfindet was. / Er schöpft aus sich / und er hat recht." Schön, aber kaum verständlich.
Kein Zweifel aber, dass es hier nicht um Physik geht, sondern um eine quasi-physikalische Analogie. Zwei Datumsangaben ("22:58:12 / Gleich Nacht", "09:49: 43 / Gleich Tag") rahmen eine Nacht ein, in der das lyrische Ich das Hin und Her des Lebens in Minizyklen von Beobachtungen und Reflexionen zu fassen sucht. Und wenn man schon das physikalische Gas-Dampf-Gemisch bemüht, dann darf man auch die lyrische Textmasse als einen dampf- und gasartigen Sprachzustand betrachten. Und folglich die formalen Reduktionen und Manipulationen als Versuche der Autorin, das Ganze überhaupt in eine Folge und ein System zu bringen.
Den Anfang dieser Geschichte einer Nacht bestimmt die Frage, ob und wie überhaupt zu sprechen ist. Eine Apnoe, ein Atemstillstand, eine Atemlähmung ist zu Anfang das Problem: "Apnoe verrat mir nur / wie geht Steine verrücken?" Dann kommt die Tödin ins Spiel, und das lyrische Ich erhofft sich Schutz und Hilfe in der Anrufung der Liebe, es präzisiert seinen Zustand in einem gereimten Zweizeiler: "Wie viel sich bewegt / wenn nur das Denken sich legt."
Aber das Denken "legt" sich nicht, jedenfalls nicht auf der in "Taupunkt" ausgemessenen Strecke dieser Nacht und ihrer wechselnden Reflexionen: "Ich kann mir nichts suchen / kann weder fliehen noch weichen / bin an den Organismus gebunden / muss in der Sesshaft bleiben." Dem Neologismus "Sesshaft" vertraut Preiwuß das Kerkerhafte der Existenz an. Doch noch am Schluss, als sie "Gleich Tag" notiert, setzt die Autorin aufs Denken: "Ich versuche Gedanken, in die ich mich legen kann." Je länger man das Mäandern der Gedanken und Eindrücke verfolgt, je weiter dieser Zyklus einer unruhigen Nacht fortschreitet, umso deutlicher wird, dass Kerstin Preiwuß ihr Konstrukt von Sparsamkeit und Dunkelheit errichtet, um Momente der Klarheit hervorzubringen.
HARALD HARTUNG
Kerstin Preiwuß: "Taupunkt".
Berlin Verlag, Berlin 2020. 112 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main