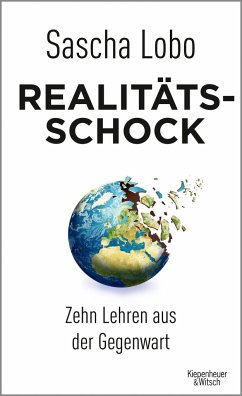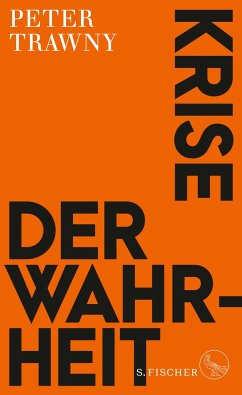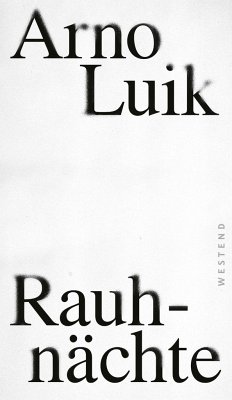Nicht lieferbar

Tausend Zeilen Lüge
Das System Relotius und der deutsche Journalismus
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Juan Morenos Bericht über den größten Fälschungsskandal seit JahrzehntenEin Reporter des «Spiegel» lieferte Reportagen und Interviews aus dem In- und Ausland, bewegend und oftmals mit dem Anstrich des Besonderen. Sie alle wurden vom «Spiegel» und seiner legendären Dokumentation geprüft und abgenommen, sie wurden gedruckt, und der Autor Claas Relotius wurde mit Preisen geradezu überhäuft. Aber: Sie waren - ganz oder zum Teil - frei erfunden. Juan Moreno hat, eher unfreiwillig und gegen heftigen Widerstand im «Spiegel», die Fälschungen aufgedeckt. Hier erzählt er die ganze Geschi...
Juan Morenos Bericht über den größten Fälschungsskandal seit Jahrzehnten
Ein Reporter des «Spiegel» lieferte Reportagen und Interviews aus dem In- und Ausland, bewegend und oftmals mit dem Anstrich des Besonderen. Sie alle wurden vom «Spiegel» und seiner legendären Dokumentation geprüft und abgenommen, sie wurden gedruckt, und der Autor Claas Relotius wurde mit Preisen geradezu überhäuft. Aber: Sie waren - ganz oder zum Teil - frei erfunden. Juan Moreno hat, eher unfreiwillig und gegen heftigen Widerstand im «Spiegel», die Fälschungen aufgedeckt. Hier erzählt er die ganze Geschichte vom Aufstieg und Fall des jungen Starjournalisten, dessen Reportagen so perfekt waren, so stimmig, so schön. Claas Relotius schrieb immer genau das, was seine Redaktionen haben wollten. Aber dennoch ist zu fragen, wieso diese Fälschungen jahrelang unentdeckt bleiben konnten. Juan Moreno schreibt mehr als die unglaubliche Geschichte einer beispiellosen Täuschung, er fragt, was diese über denJournalismus aussagt.
Ein Reporter des «Spiegel» lieferte Reportagen und Interviews aus dem In- und Ausland, bewegend und oftmals mit dem Anstrich des Besonderen. Sie alle wurden vom «Spiegel» und seiner legendären Dokumentation geprüft und abgenommen, sie wurden gedruckt, und der Autor Claas Relotius wurde mit Preisen geradezu überhäuft. Aber: Sie waren - ganz oder zum Teil - frei erfunden. Juan Moreno hat, eher unfreiwillig und gegen heftigen Widerstand im «Spiegel», die Fälschungen aufgedeckt. Hier erzählt er die ganze Geschichte vom Aufstieg und Fall des jungen Starjournalisten, dessen Reportagen so perfekt waren, so stimmig, so schön. Claas Relotius schrieb immer genau das, was seine Redaktionen haben wollten. Aber dennoch ist zu fragen, wieso diese Fälschungen jahrelang unentdeckt bleiben konnten. Juan Moreno schreibt mehr als die unglaubliche Geschichte einer beispiellosen Täuschung, er fragt, was diese über denJournalismus aussagt.