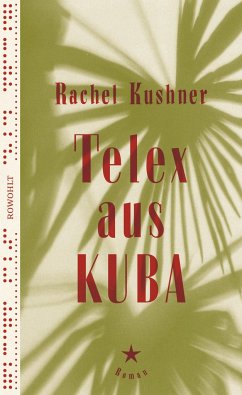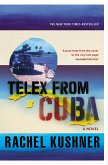In 'Telex aus Kuba', einem packenden Roman über die kubanische Revolution, sind sie alle versammelt - die Castros, Che Guevara, der Diktator Batista und US-Präsident Eisenhower.
Aber erzählt wird die Geschichte hauptsächlich von zwei Jugendlichen, Everly Lederer und K.C. Stites, die füreinander bestimmt zu sein scheinen: sie die Tochter des Chefs einer amerikanischen Nickelmine und er der Sohn eines leitenden Angestellten der United Fruit Company. Aus den Brüchen zwischen dem, was sie voller Faszination und Erschrecken wahrnehmen, tritt allmählich die Geschichte eines ebenso wagemutigen wie bisweilen absurden Freiheitskrieges zutage.
Verwickelt in ihn sind, mit oft dubiosen Interessen, auch ein französischer Agent mit SS-Vergangenheit, eine kubanische Tänzerin mit erotischem Hang zur Macht, zahlreiche karrierebewusste Saubermänner und ihre dekadenten Gattinnen, Dschungelkämpfer und schmutzige Geschäftemacher.
Rachel Kushner hat einen tropisch glitzernden historischen Moment des 20. Jahrhunderts mit großer Raffinesse so verdichtet, dass er die Ereignisse wie durch ein Brennglas zeigt. Man liest mit allen Sinnen, sieht, schmeckt, fühlt mit den Figuren und überlässt sich Kushners herausragender erzählerischer Kraft.
Aber erzählt wird die Geschichte hauptsächlich von zwei Jugendlichen, Everly Lederer und K.C. Stites, die füreinander bestimmt zu sein scheinen: sie die Tochter des Chefs einer amerikanischen Nickelmine und er der Sohn eines leitenden Angestellten der United Fruit Company. Aus den Brüchen zwischen dem, was sie voller Faszination und Erschrecken wahrnehmen, tritt allmählich die Geschichte eines ebenso wagemutigen wie bisweilen absurden Freiheitskrieges zutage.
Verwickelt in ihn sind, mit oft dubiosen Interessen, auch ein französischer Agent mit SS-Vergangenheit, eine kubanische Tänzerin mit erotischem Hang zur Macht, zahlreiche karrierebewusste Saubermänner und ihre dekadenten Gattinnen, Dschungelkämpfer und schmutzige Geschäftemacher.
Rachel Kushner hat einen tropisch glitzernden historischen Moment des 20. Jahrhunderts mit großer Raffinesse so verdichtet, dass er die Ereignisse wie durch ein Brennglas zeigt. Man liest mit allen Sinnen, sieht, schmeckt, fühlt mit den Figuren und überlässt sich Kushners herausragender erzählerischer Kraft.

Mit "Flammenwerfer" ist Rachel Kushner berühmt geworden. Nun erscheint in Deutschland auch ihr Debütroman "Telex aus Kuba"
Als Rachel Kushners zweiter Roman "Flammenwerfer" vor vier Jahren in den Vereinigten Staaten erschien, waren die Kritiker hingerissen. Der "New Yorker" widmete ihr gleich fünf Seiten, als erste Person überhaupt wurde Kushner sowohl mit ihrem Debüt als auch mit diesem zweiten Buch für den National Book Award nominiert. Und auch in Deutschland las man euphorische Porträts über die Autorin mit der aufregenden Biographie: geboren 1968 in Eugene, Oregon, Studium der politischen Ökonomie in Berkeley und Florenz, Master in "Creative Writing" bei Jonathan Franzen, Kunstkritikerin mit großer Leidenschaft für Skirennen und schnelle Motorräder. Zwei Jahre nach "Flammenwerfer" erscheint nun auch ihr Debüt, "Telex aus Kuba", in deutscher Übersetzung. Normalerweise sind die Erwartungen an den zweiten Roman besonders hoch. Hier ist es umgekehrt.
Rachel Kushner liebt die Revolution: Wie in "Flammenwerfer", der von den Roten Brigaden in Italien erzählt, wählt die Autorin auch hier ein Thema mit revolutionärer Sprengkraft: das Kuba der fünfziger Jahre. Nach dem Sturz des Präsidenten Prío wird auch dessen Nachfolger Batista nicht lange an der Macht bleiben, denn zwei kubanische Brüder sind dabei, die Geschichte des Landes grundlegend zu verändern. Doch geht es bei Kushner überraschenderweise kaum um diese Revolutionäre. Fidel und Raúl sind eher Statisten, die ab und zu mal auftauchen - wobei ihre sexuellen Vorlieben eine erstaunlich große Rolle spielen. Die beiden Hauptfiguren - wenn man davon sprechen kann, der Roman hat eine Reihe von Protagonisten und wechselt ständig die Perspektive - sind K. C. Stites und Everly Lederer, die Kinder zweier amerikanischer Unternehmerfamilien, die sich im kubanischen Dschungel ein erfolgreicheres Leben versprechen. Sie wachsen in großen Häusern mit Hausangestellten auf, die Welt hier, so wird ihnen vermittelt, gehört den Amerikanern.
Kuba, so wie Rachel Kushner es schildert, wimmelt von Menschen dieser Art: Versagern, Verbrechern, denjenigen, die in den Vereinigten Staaten keine Zukunft mehr haben, weil sie der Justiz entgehen müssen oder nicht erfolgreich sind. Sie alle finden sich hier zusammen, um sich als tadellose Geschäftsmänner über die kubanische Bevölkerung zu erheben. Er fühle sich als "cubano", ruft da einer, der kein Spanisch spricht und eigentlich nur in Havanna ist, weil ihm die amerikanischen Anwälte auf den Fersen sind. Obwohl sie in ähnlichen Verhältnissen aufwachsen, begegnen Everly und K. C. den Begebenheiten auf unterschiedliche Art. Während Everly durchaus kritisch ist und sich in den haitianischen Diener der Familie verliebt, hält K.C. auch Jahrzehnte später noch am Weltbild seiner Eltern fest. So sehr vergöttert er die Mutter, dass selbst seine Schwärmerei für Everly eher mütterlichen Wunschvorstellungen als eigener Zuneigung zu entspringen scheint.
Als Einziger Ich-Erzähler des Romans ist K. C. im Zentrum und doch am Rand. Nicht er wird zum Revolutionär, sondern sein Bruder Del, der statt zum jährlichen Shoppingausflug nach Miami mitzukommen, die elterliche Zuckerplantage anzündet. K. C. versteht die Welt nicht mehr, und auch der Leser kann nur erahnen, was in Del vorgeht, denn seine Perspektive wird, genau wie die vieler anderer Personen, von denen man eigentlich gerne mehr erfahren würde, nie geschildert. Stattdessen werden die Sorgen etlicher amerikanischer Hausfrauen beschrieben, die zu viel trinken und genervt von ihren Ehemännern sind. Auch nicht ganz neu - man wünscht sich dann doch ein bisschen mehr revolutionäre Energie.
Doch macht diese Randperspektive das Buch auch interessant. Es erzählt eben nicht von der Revolution, sondern von der Gesellschaft, in der sie entsteht. Von einer amerikanischen Bevölkerung, die sich das baldige Ende ihres bisherigen Lebens nicht eingestehen möchte und stattdessen umso wildere Partys feiert. Von einer Regierung, die teilhaben will an diesem Reichtum und deshalb kooperiert. Es erzählt deutlich weniger von den Kubanern, den Plantagenarbeitern und Dienstboten. Allein Willy, der Diener der Lederers, in den Everly sich verliebt, stellt die andere Seite dar. Doch auch er kommt fast nie selbst zu Wort, sondern wird meist nur durch Everlys Augen beschrieben. Diese Auslassung wirkt so merkwürdig, dass sie die sozialen Ungleichheiten umso deutlicher macht. Wie kann es sein, dass die Dienstboten nicht sprechen? Sie sprechen nicht, weil sie in dieser Gesellschaft nichts zu sagen haben. Dass sich diese Machthierarchie im Sprechen beziehungsweise Schweigen der Figuren ausdrückt, ist eine der Stärken des Romans, der gerade dann berührend ist, wenn das koloniale Selbstverständnis der Amerikaner auf die anderen Einwohner der Insel trifft.
Kushner braucht häufig nur wenige Sätze, um solche Strukturen zu skizzieren und in ihrem ganzen Rassismus bloßzustellen. Wenn etwa Mrs. Stites, "eine Liberale, aber so liberal nun auch wieder nicht", ihrem Sohn verbietet, die farbige Haushälterin zu umarmen - und zur Kontrolle an ihm schnuppert. Oder wenn die Freundschaft der Familie mit Herrn Bloussé ein abruptes Ende nimmt, weil sich herausstellt, dass dieser eine haitianische Frau und dementsprechend schwarze Töchter hat. Doch auch Bloussé ist nicht so liberal, wie man denken könnte, sondern "hat sich entschieden, in einer schwarzen Welt zu leben, in der er über alle herrscht". Schwarz sein, das ist im Roman eine Frage der Rasse und nicht der Hautfarbe: "Negroide Albinos", so Everlys Mutter, stelle sie nicht ein, denn sie "seien das Traurigste auf der ganzen Welt". Und eines möchte man auf keinen Fall: zu viel Tristesse im Haus.
Der Rassismus, er ist überall, nicht nur unter Weißen: Annie, die jamaikanische Haushälterin der Stites, bedient keine Schwarzen. Jeder findet immer einen, der noch tiefer steht. Kushner gelingt es fabelhaft, die Selbstverständlichkeit dieser Logik aufzuzeigen, indem sie vor allem K. C. von diesen Situationen erzählen lässt, der das alles zwar nicht ganz versteht, aber hinnimmt. Er ist alt genug, die Haltungen seiner Eltern zu übernehmen, aber noch zu jung, um sie voll und ganz zu teilen.
Ein paar Dinge stören dann aber doch: Dass Hemingway jeden Tag im "Floridita" abhängt und niemand mit ihm tanzen will, wirkt ebenso seltsam erzwungen wie die Darstellung des heimlich schwulen und sexuell übergriffigen Fidel Castro. Man glaubt der Geschichte dadurch eher weniger als mehr, weil man das Gefühl hat, Kushner habe da jetzt unbedingt noch ein wenig Lokalkolorit reinpacken wollen. Achtung, wir sind in Kuba, das ist alles wirklich passiert! Anders verhält es sich mit weniger bekannten, aber interessanteren historischen Figuren. Mit dem Franzosen La Mazière zum Beispiel, der im Zweiten Weltkrieg für die Waffen-SS gearbeitet hat und nun auf Kuba den Rebellen das Töten beibringt - mehr aus Abenteuerlust als aus Überzeugung. Seine Liebesgeschichte mit der kubanischen Prostituierten Rachel K, die sich mit Männern aller Seiten, den Castros, Prío, Batista und auch K. C.s Vater einlässt, gibt dem Roman zeitweise den Anstrich eines Agententhrillers.
So richtig spannend wird es leider trotzdem nicht. Durch den ständigen Wechsel der erzählenden Personen ergibt sich zwar ein vielschichtiges Bild, es verhindert aber auch, dass die Handlung so richtig in Fahrt kommt. Man weiß, die Revolution steht unmittelbar bevor, mit viel Aufregung erwartet man sie aber nicht. Auch drängt es einen nicht unbedingt zu erfahren, was denn nun eigentlich mit den Protagonisten passiert, dafür bleiben sie häufig eine Spur zu farblos. Mrs. Billings, Mrs. Mackey, Mrs. LaDue, Mrs. Carrington - wer da nun gerade welche Befindlichkeit hat, ist einem leider irgendwann ein bisschen egal.
Als auf den letzten Metern die Revolution dann endlich mal losgeht und Castro seine Reden schwingt, wirkt das nicht wie ein rundes Finale, sondern eher wie ein Fremdkörper in einem Roman, in dem eigentlich die ganze Zeit von anderen Leuten die Rede war. Denn Rachel Kushners "Telex aus Kuba" ist dann doch kein Revolutionsroman. Er erzählt von Freunden, Ehepaaren und Familien in einer Gesellschaft voll Rassismus und sozialer Ungleichheit. Für diese Geschichten braucht es die große Politik nicht. Ein Sohn kann Rebell sein, ohne zum Revolutionär zu werden - die amerikanische Kolonialblase bietet dafür Anlass genug.
ANNA VOLLMER
Rachel Kushner: "Telex aus Kuba". Roman. Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell. Rowohlt, 464 Seiten, 19,95 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Mitreißend und dicht findet Jörg Häntzschel Rachel Kushners jetzt bei uns erscheinenden Debütroman von 2008. Die mit Thriller-Elementen versetzte Geschichte über den privatwirtschaftlichen Kolonialismus der USA auf Kuba erzählt zum Großteil aus der Perspektive der Kinder amerikanischer Großgrundbesitzer, wie Häntzschel erklärt, besticht durch Kushners Fähigkeit die Erzählstimmen und die Weltgeschichte zu orchestrieren und ihren Text freizuhalten von Besserwisserei, meint der Rezensent. Den "ethnologischen Blick" hat der Leser ohnehin nach kürzester Zeit von diesem Buch antrainiert bekommen, erklärt er.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Telex aus Kuba ist so rätselhaft und geheimnisvoll, als würde dir jemand eine dieser superfarbgesättigten Postkarten aus einem fernen Land schicken. Heidi Julavits
Ein brillant gemaltes, verspieltes, literarisch anspielungsreiches und farbiges Revolutionspanorama. Faszinierend. Die Welt