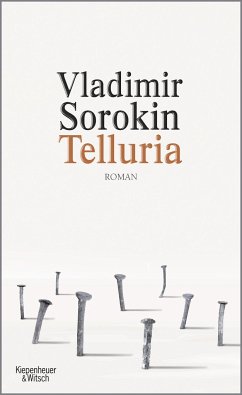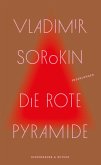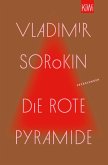Ein vielstimmiges Meisterwerk vom wichtigsten zeitgenössischen Autor Russlands
Nach dem von der Kritik gefeierten und preisgekrönten Roman »Der Schneesturm« setzt Vladimir Sorokin mit seinem neuesten Werk noch einen drauf: ein fulminanter literarischer Rundumschlag, der den Zustand der Welt und der Menschen darin um die Mitte des 21. Jahrhunderts zum Thema hat und auf den die aktuellen Weltereignisse bereits zu verweisen scheinen. Eurasien, Mitte des 21. Jahrhunderts: Die Welt ist nach verschiedenen Religionskriegen, Revolutionen und Aufständen in weitgehend voneinander isolierte Kleinstaaten zerfallen, in denen unterschiedlichste politische Machtstrukturen herrschen. Es gibt u.a. das kommunistisch-orthodoxe Moskowien, eine Sowjetische Sozialistische Stalinrepublik und ein feudalistisches Neukölln mit Konrad von Kreuzberg an der Spitze, der die Salafisten zurückgeschlagen hat. Köln ist eine Republik geworden, und dann ist da noch die kleine, feine Bergrepublik Telluria, aus der das kommt, was alle Menschen in diesem Meer der Barbarei haben wollen: das ultimative Mittel, das beständiges Glück erzeugt. Das Leben nach der Katastrophe ist durchaus nicht immer depressiv, man hat sich darin eingerichtet. Sorokin entfacht in diesem neuen Roman ein Feuerwerk der Poly-phonie, in 50 verschiedenen Texten fabuliert, imaginiert und parodiert er, spielt mit verschiedenen Textformen und schafft so eine großartige, wenn auch düstere Satire, die ihresgleichen sucht. An der Übertragung dieses brillanten Werks waren acht renommierte Übersetzer beteiligt.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Nach dem von der Kritik gefeierten und preisgekrönten Roman »Der Schneesturm« setzt Vladimir Sorokin mit seinem neuesten Werk noch einen drauf: ein fulminanter literarischer Rundumschlag, der den Zustand der Welt und der Menschen darin um die Mitte des 21. Jahrhunderts zum Thema hat und auf den die aktuellen Weltereignisse bereits zu verweisen scheinen. Eurasien, Mitte des 21. Jahrhunderts: Die Welt ist nach verschiedenen Religionskriegen, Revolutionen und Aufständen in weitgehend voneinander isolierte Kleinstaaten zerfallen, in denen unterschiedlichste politische Machtstrukturen herrschen. Es gibt u.a. das kommunistisch-orthodoxe Moskowien, eine Sowjetische Sozialistische Stalinrepublik und ein feudalistisches Neukölln mit Konrad von Kreuzberg an der Spitze, der die Salafisten zurückgeschlagen hat. Köln ist eine Republik geworden, und dann ist da noch die kleine, feine Bergrepublik Telluria, aus der das kommt, was alle Menschen in diesem Meer der Barbarei haben wollen: das ultimative Mittel, das beständiges Glück erzeugt. Das Leben nach der Katastrophe ist durchaus nicht immer depressiv, man hat sich darin eingerichtet. Sorokin entfacht in diesem neuen Roman ein Feuerwerk der Poly-phonie, in 50 verschiedenen Texten fabuliert, imaginiert und parodiert er, spielt mit verschiedenen Textformen und schafft so eine großartige, wenn auch düstere Satire, die ihresgleichen sucht. An der Übertragung dieses brillanten Werks waren acht renommierte Übersetzer beteiligt.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Der Schriftsteller Wladimir Sorokin erzählt in seinem neuen Roman von den Drogen und Kämpfen der Zukunft
Mit verschränkten Armen steht der bekannteste und beste Schriftsteller Russlands in seiner Wohnung in Berlin-Charlottenburg und sagt, dass er nicht mehr schreiben kann. Er sagt nicht "ich" dabei. Er sagt: "Es schreibt sich nicht mehr", und vermeidet es, einen dabei anzusehen. Seit zwei Jahren sei das so, seit er "Telluria" beendet habe, seinen letzten Roman, der ihm viel abverlangt hat. "Ich habe das Gefühl, leer zu sein seitdem. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was ich nach ,Telluria' schreiben werde."
Wladimir Sorokin setzt sich hin und sagt dann eine Weile lang gar nichts. So sieht man ihn an, seine eindrucksvolle Erscheinung, das silbergraue Haar, den für ihn typischen Spitzbart, breite Schultern, viele Silberringe an den Fingern. Und es fällt einem "Stalker" ein, der Science-Fiction-Film von Andrej Tarkowskij aus den siebziger Jahren, in dem es doch diesen Schriftsteller gibt, dem die Eingebung abhandengekommen ist und der, in der Hoffnung, sie wiederzuerlangen, in die Zone will, in den sogenannten Raum der Wünsche. Sorokin hofft kaum auf einen solchen Raum, er wartet ab.
Aber die Zone, denkt man, diese techno-romantische Ruinenlandschaft der Zukunft, hat in gewisser Weise eine Menge mit seinen Romanen zu tun, genauso wie mit den Romanen von Michel Houellebecq. Eine Literatur der Zukunft, die die Gegenwart und die Vergangenheit reflektiert: Das ist das Genre, das beide Schriftsteller in den vergangenen Jahren zur Meisterschaft gebracht haben, wenn auch in völlig unterschiedlicher Sprache. Ihre literarischen Entwürfe der nahen Zukunft sind präzise Analysen dessen, was genau jetzt sich abzeichnet: in Europa, in Russland, in der ganzen Welt. Sie gehören zum Interessantesten, was die Literatur gerade zu bieten hat.
Sorokin zeigt auf ein Gemälde hinter sich an der Wand. "Ein Selbstporträt", sagt er und guckt, ob man auch lacht. Auf dem Bild spaziert unter einem riesigen dunklen Wolkenhimmel ein winziges braunes Mammut auf vereister Erdoberfläche entlang. Der Mammutschriftsteller vor dunkler Kulisse. Nur ist dieses Bild eigentlich gar nicht so lustig, sondern korrespondiert tatsächlich mit der Stimmung, die man in Sorokins Romanen findet. Mit dem Gefühl, sich sehr klein zu fühlen angesichts dessen, was sich als Gemisch aus Last der Vergangenheit und Drohung der Zukunft vor und über einem auftürmt. Eine Staffelei steht in der Ecke. Also schreibt er nicht mehr, aber malt dafür? Er male nur hier in Berlin, sagt Wladimir Sorokin, ohne es näher erklären zu wollen. Zu Hause in Moskau (oder besser: außerhalb von Moskau, Moskau selbst erträgt er nicht mehr, überhaupt wohne er hier und dort, "auf halber Strecke zwischen Ordnung und Unordnung") male er nie.
"Telluria" erscheint in dieser Woche, pünktlich zum sechzigsten Geburtstag des Autors, in der deutschen Übersetzung. Es geht darin um ein Land der Zukunft, benannt nach Tellur, einem seltenen chemischen Element. "Es ist ein silberweißes, glänzendes Halbmetall, das so ähnlich wie Zinn aussieht", sagt Sorokin. "Ein schönes Wort, finden Sie nicht? Für ein so ungewöhnliches Land klingt es genau richtig." Im Roman wird die demokratische Bergrepublik Telluria am 17. Januar 2028 auf dem Gebiet der Provinz Altai ausgerufen und zum Sehnsuchtsland aller Russen und Europäer, weil von dort die neue Droge kommt, die mit der transsibirischen Eisenbahn aus dem Land heraustransportiert wird: Tellur, der kalte Irrsinn, der absolute Knaller, das reine Glück, eine Art ideologisches Doping, das den Mangel an Heroismus kompensiert, unter dem die Menschen in Eurasien Mitte des 21. Jahrhunderts leiden. Erhältlich ist es in Form von Nägeln, die nach einer Kopfrasur von Zimmermännern in die Schädel eingeschlagen werden. Fünf Tage kann der Trip dauern. Die Sterblichkeitsrate ist hoch. Die Leute sind verrückt danach.
Wer schon einmal Romane von Sorokin gelesen hat, wundert sich hier natürlich überhaupt nicht, sondern fühlt sich gleich wie zu Hause: Wladimir Sorokin ist in den vergangenen Jahren so etwas wie ein Spezialist für die Drogen der Zukunft geworden: In seiner "Ljod"-Trilogie fingen Menschenherzen, die vom Eishammer der Mitglieder einer Sekte getroffen wurden, an zu sprechen. In "Der Tag des Opritschniks", seinem Roman über die Leibgarde Iwan des Schrecklichen, die er als Bruderschaft von Verbrechern im Staatsdienst von morgen phantasierte, waren es kleine Fische, die sich in die Venen bissen und in den Blutbahnen der männlichen Untertanen verschwanden, woraufhin sich deren Schwänze erhoben. Und hier nun die Tellurnägel, wieder ein Akt des gewaltsamen Eindringens in den Körper und die Inkaufnahme eines ungeheuren Risikos, um sich verblenden zu lassen und sich endlich mächtig zu fühlen. Wobei das Gefühl der Macht größer ist als die tatsächliche Stärke. Tellur nehmen in Sorokins Buch auch die jungen Männer, die in den Krieg gegen Islamisten ziehen: "Du zogst in den Kampf gegen den Feind, und das edle Metall in deinem Kopf gab dir Kraft und Ausdauer, es erfüllte dich mit Tapferkeit, Kühnheit und dem edlen Zorn des heiligen Kriegs!" Das Paradox ist nur, dass die Gegner, die jungen Kämpfer des Dschihads, sich kein Metall in den Kopf jagen müssen, um Helden zu werden, weil ihre Köpfe von klein auf mit heroischen Idealen vollgestopft wurden. Weil aber für die Tellursüchtigen die Nägel unverzichtbar sind, verlieren sie in "Telluria" den Kampf.
Dass sich in seinem neuen Roman Motive der vorhergehenden wiederfinden, interessiert Wladimir Sorokin selbst überhaupt nicht. "Das mag Ihnen so vorkommen", sagt er. "Für mich ist es aber etwas ganz Neues, ein neuer Stoff mit einer neuen Struktur. Ich wollte seit langem schon mal so einen Text schreiben, in dem die einzelnen Kapitel inhaltlich und stilistisch voneinander abweichen." "Telluria" ist darin ja auch tatsächlich neu: Immer andere Stile und Stimmen prallen aufeinander, die ein Übersetzerkollektiv mit dem lustigen Namen "Hammer und Nagel" ins Deutsche übertragen hat. Manche klingen wie alte Märchen, andere wie orientalische Erzählungen, dann wieder wie Reportagen oder wie zeitgenössischer Slang. Es ist eine Herausforderung, sich inmitten dieses Wechsels beim Lesen zurechtzufinden, auch weil man das Gefühl hat, die historischen Anspielungen gar nicht alle erfassen zu können. Nur macht es einem erstaunlicherweise nichts aus, wenn sich nicht alles gleich vollständig erschließt, weil die Erzählung einen trotzdem weiterträgt, die Atmosphäre des Sorokin-Universums einen gefangen hält, ganz so, als wäre man selbst das Mammut auf der Eisscholle unter einem sehr dunklen Zukunftshimmel.
Neu ist diesmal vor allem aber noch etwas ganz anderes: "Telluria" erzählt nicht nur von Russland, sondern auch von Europa. "Sogar in größerem Maße von Europa als von Russland", sagt Sorokin. "Es geht um Europa und Asien, da gibt es auch den Ural und Altai. Es geht um diesen Kontinent zwischen Atlantik und Pazifik, auf dem ich, wahrscheinlich, weil ich da lebe, das Gefühl habe, mich mehr oder weniger auszukennen. Der Roman zeichnet ihn als multipolare Welt. Eine Welt, die sich zerteilt hat in viele Staaten, die nicht mehr an Nationen gebunden sind. Eigentlich ist es ein Buch über die Kleinteilung der Welt, über das Ende der Globalisierung und den Zerfall in kleine Gebiete." Man muss sich das im Einzelnen so vorstellen: In Köln wird nach drei Jahren Talibanherrschaft wieder Karneval gefeiert. Der Kleinstaat SSSR, "Stalinistische Sozialistische Sowjetrepublik", der von einem Oligarchen gegründet wurde, ist zum Eldorado für Linksradikale aller Parteien geworden. Moskau hat sich durch eine Mauer von der Außenwelt abgeschottet, so ohne weiteres kommt keiner raus, kilometerlang sind die Schlangen für die Ausreise aus dem "Staat des Vampirs", und sie kostet tausend Goldrubel herrscherliche Ausreisegebühr. Und Telluria wird von einem französischen Präsidenten regiert, Oberst Jean-François Trocart, Kommandeur der Legion "Blaue Hornissen".
Sorokin zeigt eine durch hybride Kriege und ökonomische Krisen völlig zersplitterte Welt und zersplittert sie dabei auch erzählerisch. Er sei sich absolut sicher, sagt er, dass man die Welt von heute nicht mehr mit linearer Prosa wiedergeben könne. Man brauche eine andere Optik, um die Struktur der Zeit aufzuspüren, so etwas wie die Facettenaugen von Insekten. Wobei er mit Zeit die Gegenwart genauso meint wie die nahe Zukunft, das, was der englische Schriftsteller und Pionier der Science-Fiction-Literatur H.G. Wells "The Shape of Things to Come" genannt hat, "Die Gestalt der zukünftigen Dinge".
Dass es irgendwann tatsächlich eine Mauer geben könnte, mit der sich Moskau vom Umland abschottet, hält Sorokin mit Blick auf seinen eigenen Roman dabei für gar nicht so unwahrscheinlich: "Ich würde mich nicht wundern, wenn man, sagen wir mal in fünf Jahren, anfinge, eine solche Mauer zu bauen. Moskau ist ein Staat im Staate. Die Beamten, die Reichen, alle leben sie da. Sie müssen sich vorstellen, dass Anfang der neunziger Jahre siebzig Prozent allen Bargelds in Moskau war. Das macht die Moskauer nicht beliebt."
Man nimmt sich vor, das im Kopf zu behalten. Denn das ist ja das Aufwühlende an den Romanen Sorokins, genauso wie an denen seines französischen Kollegen Michel Houellebecq: dass das, was sie in ihrer Literatur als Zukunft entwerfen, von der Gegenwart eingeholt zu werden scheint. Sie deshalb für Propheten zu halten wäre falsch. Grundsätzlich ist es ja eine alberne Idee, Schriftstellern zugutezuhalten, was sie angeblich alles vorausgesehen hätten. Literatur ist schließlich keine Wahrsagerei, und Autoren sind keine Seher. Wladimir Sorokins wie auch Michel Houellebecqs Kunst besteht darin, die in der Gegenwart sich abzeichnenden Tendenzen so präzise zu analysieren, sie ernst zu nehmen, weiterzuphantasieren und zu überzeichnen, dass ihre literarischen Entwürfe retrospektiv wie eine Vorwegnahme von Zukunft erscheinen, obwohl sie im Grunde allein von der Gegenwart handeln. Deshalb ist es nicht nur interessant, wie sich "Telluria" jetzt, sondern auch, wie sich der Roman in ein paar Jahren liest.
Als "Der Tag des Opritschniks" schon eine Weile erschienen war, Sorokins letzter Roman von 2007, der eine Schreckensvision von Russland im Jahr 2027 entwarf, bekam der Autor Komplimente der Jugendorganisation der neuimperialen Eurasier, die den Roman als prophetisches Werk begrüßten, das vorführe, was Russlands inneren Feinden blühe. Er bekam auch Lob aus dem Kreml, auch wenn es niemanden gab, der ihm dieses Lob persönlich überbrachte. Es war eher ein Gerücht, demzufolge man sich freue, dass die Wirklichkeit so sei "wie bei Wladimir Sorokin". Das seien Zyniker gewesen, sagt Sorokin, "die ganz genau wussten, was sie tun, wenn sie mich loben". Die Schreckensvision für salonfähig zu erklären: Das ist die abgefeimte Art der politischen Vereinnahmung von Literatur.
Sorokin hat das nicht davon abgehalten, weiterzumachen: "Erschüttern müssen wir die Kremlmauern!", heißt der erste Satz von "Telluria". Und einen Absatz weiter: "Nicht erschüttern, sondern zerschmettern. Und nicht Mauern, sondern morsche Köpfe." In den vergangenen Monaten hat er viele Artikel zur Ukraine geschrieben, sich immer wieder zu Wort gemeldet. Er fühle sich frei, sagt er. Noch störe ihn niemand bei der Arbeit. In Russland hätten Schriftsteller immer ein Problem mit der Macht gehabt, zu allen Zeiten. Und er wissen, dass ihn das auch ereilen könne, er sei zu allem bereit. "Für einen Schriftsteller", sagt er, "gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder du hast Angst, oder du schreibst."
Und auch wenn er nicht weiß, was er als Nächstes schreiben wird, macht ihm das jetzt keine Angst. Er sitzt vor dem Werk seiner zersplitterten Welt und schweigt. "Schweigen", sagt er, "gehört auch dazu."
JULIA ENCKE.
Wladimir Sorokin: "Telluria". Roman. Aus dem Russischen von Kollektiv Hammer und Nagel. Verlag Kiepenheuer & Witsch, 414 Seiten, 22,99 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Als großen Hexenmeister der Postmoderne feiert Sonja Margolina den russischen Schriftsteller Wladimir Sorokin, der auch in seinem neuen Roman "Telluria" mit allen literarischen Mitteln der Auflösung der Welt beizukommen trachtet: Europa und Russland sind in Klein- und Kleinststaaten zerfallen, teils stalinistischer, teils christlich, teils islamischer Prägung; die Menschen nähren ihren Idealismus aus Tellur-Nägeln, die sie sich als Droge ins Hirn jagen lassen. Dass Sorokins Visionen oft genug Realität wurden, macht für Margolina nur einen Teil ihrer Qualität aus. Zum anderen speist sich ihre Faszination für diesen Autor aus seiner stilistischen Vielfalt - jedes Kapitel von "Telluria" entspricht einer anderen literarischen Gattung - und seiner Verankerung in der russischen Literaturgeschichte. Die vielen historischen und klassischen Verweise, Zitate und Neologismen sind unmöglich bei einer Übersetzung zu retten, weiß Margolina, die trotz dieses Verlusts die Entscheidung richtig findet, den Roman vom Kollektiv Hammer und Nägel übertragen zu lassen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
» Telluria ist ein großes [...], sogar geniales Werk.« Tiroler Tageszeitung 20151128