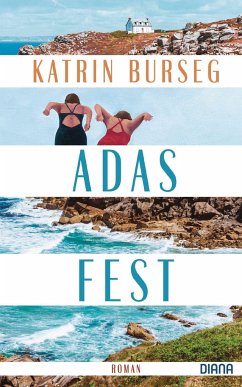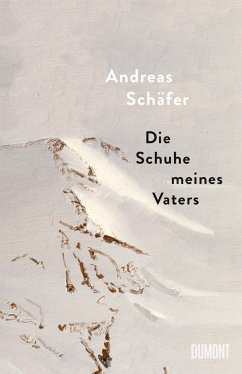-50%12)

Sofort lieferbar
Gebundener Preis: 24,00 € **
Als Mängelexemplar:
Als Mängelexemplar:
**Frühere Preisbindung aufgehoben
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
6 °P sammeln!
Minimale äußerliche Macken und Stempel, einwandfreies Innenleben. Schnell sein! Nur begrenzt verfügbar.





Es ist Nilufars erste Reise nach Iran und in eine ihr unbekannte Familie - die Familie ihres Vaters, der sie verlassen hat, als sie noch ein junges Mädchen war, und zurück in seine Heimat gegangen ist. Dort trifft sie auf neue Gesichter, die alle ihre Wunden und Sehnsüchte haben, und eine Gesellschaft voller Gegensätze. Nilufar lernt ein Leben kennen, das hätte ihres sein können, und einen Vater, der ihr immer dann ausweicht, wenn sie ihm nahekommt. Umgeben vom Chaos der ständig fließenden Hauptstadt Teheran und der wohlmeinenden Gastfreundschaft ihrer Verwandten entblättert Nilufar S...
Es ist Nilufars erste Reise nach Iran und in eine ihr unbekannte Familie - die Familie ihres Vaters, der sie verlassen hat, als sie noch ein junges Mädchen war, und zurück in seine Heimat gegangen ist. Dort trifft sie auf neue Gesichter, die alle ihre Wunden und Sehnsüchte haben, und eine Gesellschaft voller Gegensätze. Nilufar lernt ein Leben kennen, das hätte ihres sein können, und einen Vater, der ihr immer dann ausweicht, wenn sie ihm nahekommt. Umgeben vom Chaos der ständig fließenden Hauptstadt Teheran und der wohlmeinenden Gastfreundschaft ihrer Verwandten entblättert Nilufar Schicht um Schicht die Zerrissenheit eines Landes, ihrer Familie und ihrer eigenen Identität.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Nilufar Karkhiran Khozani, 1983 in Gießen geboren, studierte Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft und Psychologie und absolvierte anschließend eine Ausbildung als Verhaltenstherapeutin. Sie veröffentlichte in verschiedenen Literaturzeitschriften. 2020 erschien ihr Gedichtband mit gesampelter Lyrik Romance Would Be a Very Fine Bonus Indeed. Sie war Artist in Residence beim PROSANOVA Festival 2020 und übersetzte das Skript Town Bloody Hall für den Film Als Susan Sontag im Publikum saß. 'Terafik' ist ihr erster Roman. Sie lebt in Berlin.
Produktdetails
- Verlag: Blessing
- Seitenzahl: 256
- Erscheinungstermin: 30. August 2023
- Deutsch
- Abmessung: 221mm x 142mm x 30mm
- Gewicht: 404g
- ISBN-13: 9783896677518
- ISBN-10: 3896677519
- Artikelnr.: 71225844
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
»Khozani ist ein mitreißendes Porträt der niemals stillstehenden Metropole Teheran gelungen und ein anrührendes Psychogramm einer jungen Frau auf der Suche nach der eigenen Identität.« Berliner Morgenpost
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensentin Ayca Balci bespricht drei Debütromane von deutschen Schriftstellerinnen, die man hierzulande unter dem Label "postmigrantische Literatur" fassen würde. Aber dagegen hat die Kritikerin einiges einzuwenden, erzählt doch eine jede der Autorinnen ihre eigene Geschichte. Dennoch macht Balci zunächst auf die Gemeinsamkeiten der Romane aufmerksam: Sowohl Nilufar Karkhiran Khozani als auch Özge Inan und Mina Hava erzählen vom Schicksal der Eltern und dem Gefühl, Sehnsucht nach einem Land zu empfinden, das sie aufgrund von Krieg oder Repressionen verlassen mussten. Karkhiran Khozani erzählt uns in "Terafik" von Psychologiestudentin Nilufar, die nach Diskriminierungserfahrungen
Mehr anzeigen
in Deutschland erst in den Straßen von Teheran ihrem Vater näher kommt, Özge Inans fünfzehnjährige Heldin Nilay zieht es in die Türkei, obwohl ihre Eltern nach dem Militärputsch 1980 fliehen mussten und die Freiheit erst in Deutschland fanden, und Mina Hava lässt ihre Heldin Seka nach Bosnien reisen, um nicht nur das Schicksal ihrer zerbrochenen Familie zusammenzusetzen, sondern auch über die fast vergessenen Kriegsverbrechen des Bosnienkrieges zu recherchieren, resümiert die Rezensentin. Sie scheint alle drei Romane mit Gewinn gelesen zu haben und hofft, dass die Autorinnen auch dann noch verlegt werden, wenn sie keine Migrationsgeschichten mehr schreiben.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Schließen
»[Ein] literarisch bemerkenswertes Debüt.« Buchkultur
Gebundenes Buch
„Terafik“ von Nilufar Karkhiran Khozani begann ich mit großer Vorfreude zu lesen. Über Iran und seine Menschen weiß ich selbst noch viel zu wenig. Klappentext und Leseprobe fand ich interessant und sehr ansprechend. Diese Freude ließ nach gut hundert Seiten …
Mehr
„Terafik“ von Nilufar Karkhiran Khozani begann ich mit großer Vorfreude zu lesen. Über Iran und seine Menschen weiß ich selbst noch viel zu wenig. Klappentext und Leseprobe fand ich interessant und sehr ansprechend. Diese Freude ließ nach gut hundert Seiten ziemlich schnell nach und kehrte sich um in Neutralität und Desinteresse. Nilufar weiß nicht gerade viel über ihren Vater, ihre Verwandten und Iran selbst. Sie ist in Deutschland aufgewachsen und ihr Vater hat sie früh verlassen. Im Heimatland ihres Vaters angekommen, muss sie sich erst zurechtfinden. Sie lernt ihre Verwandten kennen und merkt sehr schnell, wie viele Gegensätze und alte Wunden vorhanden sind. Der Kontakt zu ihrem Vater besteht mal mehr und mal weniger.
Ich habe schon sehr lange kein Rezensionsexemplar mehr abgebrochen. Aber hier hatte ich keinen Antrieb mehr. Mir blieben alle Figuren seltsam fremd und weit entfernt. Mir waren die Orts- und Zeitenwechsel zu viel (Gießen 1989, Berlin 2016, Rabenau 1999, Teheran 2016, Gießen 1986, Frankfurt 1981, …). Nach den ersten 100 Seiten hab ich weitere 44 Seiten gelesen und für mich dann damit abgeschlossen. Das war zu durcheinander und zu wenig aussagekräftig. Mit Zerrissenheit und Identitätssuche hab ich es wohl nicht so. Die Geschichte wirkt nach zu viel gewollt und unglücklich erzählt.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Nilufar Karkhiran Khozani schreibt über ihre eigenen Erfahrungen. Sie schreibt wortgewaltig, kraftvoll, emotional und doch auch sachlich. Die Wurzel hat sie in Iran und ist in Deutschland aufgewachsen. Kurze und mit viel Feingefühl geschriebene Kapitel erzählen von ihrer Kindheit, von …
Mehr
Nilufar Karkhiran Khozani schreibt über ihre eigenen Erfahrungen. Sie schreibt wortgewaltig, kraftvoll, emotional und doch auch sachlich. Die Wurzel hat sie in Iran und ist in Deutschland aufgewachsen. Kurze und mit viel Feingefühl geschriebene Kapitel erzählen von ihrer Kindheit, von den ersten Jahren ihres Vaters in Deutschland, vom komplizierten Verhältnis zu ihrer Mutter und insbesondere über die Reise in den Iran, das Land, in dem die Eltern aufgewachsen sind und ein Teil der Familie lebt. Sie bleibt bei ihren Erzählungen, so wirkt es, authentisch und grundehrlich. In Summe ergibt sich daraus für die Leser eine grenzüberschreitende Erfahrung, nicht unbedingt ein Aufeinanderprallen von Kulturen, vielmehr ein Ineinanderwachsen von Kulturen. Eingerahmt wird das Buch von einem sehr gut gemachten Cover. Empfehlenswert.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
In dieser Geschichte wird vom Leben von Nilufar erzählt, die sich auf die Suche nach der Heimat ihres Vaters macht.
Die Geschichte zeigt einen Ort, an der sie hätte leben können, wenn nicht alles so gelaufen wäre und ihr Vater sie nicht verlassen hätte.
Der Roman …
Mehr
In dieser Geschichte wird vom Leben von Nilufar erzählt, die sich auf die Suche nach der Heimat ihres Vaters macht.
Die Geschichte zeigt einen Ort, an der sie hätte leben können, wenn nicht alles so gelaufen wäre und ihr Vater sie nicht verlassen hätte.
Der Roman beschäftigt sich viel mit Nilufars Indentität, auch damit wie sich ihr Leben in Deutschland zunächst angefühlt hat.
Der Schreibstil der Autorin hat mich auch sehr mitgerissen, da dieser das Buch noch emotionaler und Tiefer wirken lässt.
Das Buch zeigt in dem wunderschönen Setting Iran auch, wie das Leben dort ist.
Es geht natürlich zentral um Nilufars Identität, aber auch um Iran, wie Menschen dort leben.
Die Gastfreundschaft, die Nilufar von ihren Verwandten dort entgegengebracht wird, steht stark im Kontrast zu der Verschlossenheit ihres Vaters.
Insgesamt hat mir das Buch gefallen und ich kann es durchaus empfehlen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
"Terafik" ist ein bewegender Roman von Nilufar Karkhiran Khozani, der die Geschichte von Nilufar erzählt, einer jungen Frau, die zum ersten Mal in den Iran reist, um die Familie ihres Vaters kennenzulernen, von dem sie als Kind verlassen wurde. Die Erzählung entfaltet sich in der …
Mehr
"Terafik" ist ein bewegender Roman von Nilufar Karkhiran Khozani, der die Geschichte von Nilufar erzählt, einer jungen Frau, die zum ersten Mal in den Iran reist, um die Familie ihres Vaters kennenzulernen, von dem sie als Kind verlassen wurde. Die Erzählung entfaltet sich in der pulsierenden Metropole Teheran, die von Gegensätzen geprägt ist - traditionelle Werte treffen auf moderne Lebensweisen, und Nilufar taucht in eine Welt ein, die sowohl vertraut als auch fremd für sie ist.
Der Roman erforscht die komplexen Beziehungen zwischen Nilufar und ihren Verwandten, die alle ihre eigenen Wunden und Sehnsüchte haben. Die wohlmeinende Gastfreundschaft ihrer Familie bildet einen starken Kontrast zu der Distanz, die sie zu ihrem Vater empfindet, der ihr immer wieder ausweicht, wenn sie versucht, ihm näherzukommen. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Nähe und Distanz bildet den Kern des emotionalen Konflikts, den Nilufar im Laufe ihrer Reise durchlebt.
Der Roman hebt auch die Schönheit und Komplexität des iranischen Lebens hervor. Teheran, als lebendige Kulisse, trägt zum Gesamtbild bei und spiegelt die facettenreiche Natur der iranischen Gesellschaft wider. Nilufar enthüllt während ihrer Reise nicht nur die zerrissene Geschichte des Landes, sondern auch ihre eigene innere Zerrissenheit und ihre Identitätsfindung.
Die Protagonistin wird als vielschichtige Figur dargestellt, die mit ihren eigenen inneren Konflikten ringt und sich auf eine Reise der Selbstentdeckung begibt. Dies macht sie für die Leser:innen besonders greifbar und sorgt dafür, dass sie sich mit ihr identifizieren können.
Nilufar Karkhiran Khozani gelingt es mit ihrer einfühlsamen Schreibweise, die Gefühle und Gedanken der Charaktere lebendig zu vermitteln, was den Leser:innen ein eindringliches Leseerlebnis beschert. Die emotionale Tiefe des Romans zieht einen in die Handlung hinein und macht es schwer, das Buch aus der Hand zu legen.
Insgesamt ist "Terafik" ein beeindruckender Roman, der die Leser:innen mit einer bewegenden Geschichte, faszinierenden Charakteren und einem atmosphärischen Setting in den Bann zieht. Die Erzählung über Familienbeziehungen, Identitätssuche und die Vielschichtigkeit des iranischen Lebens wird sicherlich lange in Erinnerung bleiben.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Das Cover hat mich sofort angesprochen, die Farbe des Titels ist so intensiv und passt zu dem reduzierten Hintergrund. Nilufars bewegende und emotionale Geschichte über ihr Leben, hat mich von den ersten Seiten gefesselt. Sie ist 7 Jahre alt als ihre Eltern sich trennen, ihre Mutter lebt mit …
Mehr
Das Cover hat mich sofort angesprochen, die Farbe des Titels ist so intensiv und passt zu dem reduzierten Hintergrund. Nilufars bewegende und emotionale Geschichte über ihr Leben, hat mich von den ersten Seiten gefesselt. Sie ist 7 Jahre alt als ihre Eltern sich trennen, ihre Mutter lebt mit ihr in Deutschland und erlaubt nicht, dass sie ihren Vater im Iran besuchen darf. Nilufars Mutter möchte das nicht. Doch ihr Vater hält weiterhin Kontakt zu ihr. Nach Jahren, in denen Nilufar sich immer wieder fragt, welche Wurzeln und Identität sie hat beschließt sie, in den Iran zu reisen. Die vielen Charaktere waren sehr facettenreich und haben die Geschichte sehr interessant gestaltet. Die Kapitel hatte eine sehr angenehme Länge und ich konnte mich richtig in die Geschichte und die Erlebnisse hineinversetzen. Die detaillierten Beschreibungen haben mir sehr gut gefallen. Es ist ein Roman über das "zu sich selbst finden" und das Näherkommen, von Verwandten, sie sich Jahre nicht gesehen haben und dennoch eine starke Bindung haben. Ein Roman, der mit noch lange im Kopf bleiben wird, ich empfehle ihn auf jeden Fall weiter.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Fiktion oder Wirklichkeit?
Zum Inhalt:
Nilufar ist das Kind einer deutschen Mutter und eines iranischen Vaters, der nach dem Embargo gegen den Iran und seinen daraus folgenden beruflichen Schwierigkeiten die Familie verlassen hat und in den Iran zurückgekehrt ist. Als Nilufar erwachsen ist, …
Mehr
Fiktion oder Wirklichkeit?
Zum Inhalt:
Nilufar ist das Kind einer deutschen Mutter und eines iranischen Vaters, der nach dem Embargo gegen den Iran und seinen daraus folgenden beruflichen Schwierigkeiten die Familie verlassen hat und in den Iran zurückgekehrt ist. Als Nilufar erwachsen ist, wird sie eingeladen, in den Iran zu kommen, um die Familie kennenzulernen.
Mein Eindruck:
Ja, es gibt durchaus Stellen, die - da wirklich gut von der Autorin beschrieben - absolut wunderbar geschildert sind und einem die fremdartige Kultur näher bringen. Wie sich die Menschen dort ihre kleinen Fluchten erkämpfen, ist lesenswert. Und auch die Familien-Grabenkämpfe sind spannend beschrieben, - perfekt als "Pack schlägt sich, Pack verträgt sich", so dass Nilufar oft den Überblick verliert, wer jetzt mit wem wieder redet oder doch nicht.
Zu großen Teilen kann man sich aber auch befremdet fühlen. Denn wenn das Buch (was die Namen, der berufliche Werdegang und die Herkunft der Autorin nahelegen) autobiografische Züge ausweisen sollte, verwundert es schon, dass die Protagonistin sich in Deutschland schnell angegriffen fühlt (z.B. von einer Kommilitonin, die sich über Nilufars Vornamen wundert), aber keinerlei Probleme hat, sich im Iran vollständig anzupassen - mit Kopftuch verhüllt und brav mit den Frauen unterwegs. Und unterwegs ist sie viel. Meistens, ohne viel von der Umgebung mitzubekommen, da sie kaum persisch spricht und sich immer alles übersetzen lassen muss, obwohl sie versichert, an ihren Wurzeln interessiert zu sein. Dass ihr Vater sie mehr oder weniger im Stich gelassen hat, sein Privatleben über die Jahre eher verschleiert hat und immer noch auf dicke Hose macht - alles kein Problem. Auch, dass er sich kaum um sie kümmert - was solls. Da ist es doch einfacher, sich in Deutschland missverstanden zu fühlen.
Mein Fazit:
Eine starke Frau, die sich trotzdem in der Opferrolle sieht. Kein Buch, das ich empfehlen würde, obwohl mir die Beschreibungen der iranischen Groß-Familie gefallen haben
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Nilufar ist die Tochter einer deutschen Mutter und eines iranischen Vaters,. Letzterer hat die kleine Familie verlassen, als Nilufar noch ein Kind war. Er kehrte damals in sein Heimatland zurück und obwohl Nilufar mittlerweile erwachsen ist, hat sie die Heimat ihres Vaters noch nie besucht und …
Mehr
Nilufar ist die Tochter einer deutschen Mutter und eines iranischen Vaters,. Letzterer hat die kleine Familie verlassen, als Nilufar noch ein Kind war. Er kehrte damals in sein Heimatland zurück und obwohl Nilufar mittlerweile erwachsen ist, hat sie die Heimat ihres Vaters noch nie besucht und kennt nur wenige ihrer dort lebenden Verwandten. Nun reist sie endlich in den Iran, um ihren Vater zu besuchen. Er und seine Verwandschaft nehmen Nilufar gut auf und sie wird wie selbstverständlich als Teil der Familie akzeptiert und stolz allen vorgestellt, die zur Großfamilie gehören.
Nilufar selbst muss jedoch ihren Platz zwischen diesen Menschen mit deren völlig andersartigen Kultur erst finden. Denn als europäisch geprägte, emanzipierte Frau, ist ihr das Rollenbild der Iranerinnen fremd. In dem Roman wird diese ihr unbekannte Welt anschaulich und lebendig beschrieben, so dass der Leser viele Einblicke in die iranische Kultur und die dortigen Gegebenheiten bekommt. Auch die innere Zerrissenheit, die das Erleben dieser völlig unbekannten Welt in Nilufar auslöst, ist gut herausgearbeitet.
Letztendlich hat sich Nilufar mit dieser Reise auf die Suche nach ihren Wurzeln begeben, nach der Geschichte ihres Vaters, nach ihrer eigenen Identität. „Wer bin ich und wer will ich sein? Was soll zu mir gehören und was nicht?“, das sind alles Fragen, die eingebettet in zwei völlig unterschiedliche Ursprungskulturen, für Nilufar von Bedeutung sind. Der Leser begleitet sie auf dieser Reise und kann verfolgen, wie die junge Frau auf ihrer Suche manch eine Antwort findet, jedoch in anderen Bereichen weiterhin eine Suchende bleibt..
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Die erste Reise in den Iran, zur unbekannten Familie. Nilufar Karkhiran Khozani ist als Tochter einer deutschen Mutter und eines iranischen Vaters in Deutschland aufgewachsen. Der Vater verließ die Familie als sie noch ein Kind war und kehrte in den Iran zurück. Nun drängt er zu …
Mehr
Die erste Reise in den Iran, zur unbekannten Familie. Nilufar Karkhiran Khozani ist als Tochter einer deutschen Mutter und eines iranischen Vaters in Deutschland aufgewachsen. Der Vater verließ die Familie als sie noch ein Kind war und kehrte in den Iran zurück. Nun drängt er zu einer Reise. Sie soll ihn besuchen, die neue Ehefrau und die Verwandten kennenlernen. Eine gleichzeitig Einblicke in ein Land der Gegensätze erhalten.
Die Autorin verbindet in diesem autobiographischen Romane unterschiedliche Elemente und Erfahrungen miteinander. Ausgehend von der Reise in den Iran dringt sie zu ihren eigenen Erinnerungen die Kindheit und Jugend in Deutschland, aber auch an die Erlebnisse des Vaters vor.
Darüber hinaus ist der Roman die Geschichte einer Vater-Tochter-Beziehung. Die Frage nach Schuld und nach Verantwortung steht im Raum, das Unausgesprochene: „Warum bist du gegangen?“.
Am eindringlichsten waren für mich jedoch die Erfahrungen von Ausgrenzung, die sowohl der Vater als auch Nilufar Jahrzehnte später erleben und die sich wie ein leuchtend roter Faden durch den Roman ziehen. Es fängt mit dem Namen an: Den Vater nennen sie im hessischen Dorf einfach Karl anstatt Khosrow. Und in den Behörden weiß man nicht recht, wie man seinen Nachnamen ins lateinische Alphabet übertragen soll. Er und sein Bruder müssen so später ihre Nachnamen unterschiedlich schreiben. In der Hochschule will man ihn um seinen Abschluss bringen und er muss dafür kämpfen, dass er ihn überhaupt bekommt.
"Warum nicht bei Siemens bleibe. Arbeiten, etwas Wohlstand vielleicht, ein guter zuverlässiger Angestellter sein. Rentenversicherung. Erfolg haben, gerade so viel wie vorgesehen. Geliehenes Glück, gegönnt von Menschen, die den Hörer auflegen, wenn sie einen Akzent am Telefon hörten."
All das setzt sich fort, wenn Nilufars Lateinlehrein fragt, woher sie so gut Deutsch könne, wenn Vermieter auflegen, wenn sie den ausländischen Namen hören und wenn sie in Behördenbriefen mit „Herr“ angesprochen wird.
Von all dem erzählt Khozani in klaren, einprägsamen Bildern. Der Roman ist Zeugnis ihrer Beobachtungsgabe und ihres Talent, Zeiten, Menschen und ihre Erlebnisse so miteinander zu verbinden, dass sie ein eindrucksvolles Gesamtbild ergeben. Für mich ein lesenswertes Buch!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Nilufar lebt zwischen zwei Welten. Geboren und aufgewachsen ist sie in Deutschland, hatte aber nie das Gefühl wirklich dazuzugehören, da sie spätestens, wenn sie ihren Namen nennt, als „Ausländerin“ gebrandmarkt ist. Ihr Vater ist Iraner, der in Deutschland studiert …
Mehr
Nilufar lebt zwischen zwei Welten. Geboren und aufgewachsen ist sie in Deutschland, hatte aber nie das Gefühl wirklich dazuzugehören, da sie spätestens, wenn sie ihren Namen nennt, als „Ausländerin“ gebrandmarkt ist. Ihr Vater ist Iraner, der in Deutschland studiert hat und hier auch Nilfurs Mutter kennengelernt hat. Als die Eltern von Nilfur sich scheiden lassen, geht ihr Vater zurück in den Iran. Im Buch begleitet man Nilufur auf ihrer Reise in den Iran und damit auf der Suche nach ihrem eigenen Ich.
Zunächst musste ich mich an den Schreibstil gewöhnen. Nilufur nimmt den Leser mit auf Reise in den Iran und ihre Gedankenwelt, erzählt Ereignisse von früher und flicht immer wieder Kommentare andere Personen ein. Anfangs ist das etwas verwirrend, aber man gewöhnt sich schnell an diesen Stil und beginnt die Zerrissenheit Nilufars nachvollziehen zu können und lernt sie langsam besser kennen.
Ein bewegendes Buch, das einen mitnimmt in die Welt einer Frau, die sich nirgends zu Hause zu fühlen scheint. Das Buch ist kein Reisebericht durch den Iran, sondern beschreibt den Weg einer Frau auf der Suche nach der eigenen Identität. Man sollte sich für dieses Buch Zeit nehmen, es ist definitiv keines, dass man schnell runter lesen kann.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Nilufar lebt in Deutschland, ihr Vater im Iran. Lange haben sie sich nicht mehr gesehen, bis der Vater seine Tochter einlädt in den Iran zu reisen und ihre Verwandten und das Leben in Teheran kennen zu lernen.
In Teheran angekommen wird sie freundlich aufgenommen und wohlmeinend umsorgt. …
Mehr
Nilufar lebt in Deutschland, ihr Vater im Iran. Lange haben sie sich nicht mehr gesehen, bis der Vater seine Tochter einlädt in den Iran zu reisen und ihre Verwandten und das Leben in Teheran kennen zu lernen.
In Teheran angekommen wird sie freundlich aufgenommen und wohlmeinend umsorgt. Zum Glück kann sie ein wenig Farsi und kann sich einigermaßen verständigen und den Gesprächen folgen. Das Leben dort findet für Frauen hauptsächlich zuhause und hinter geschlossenen Gardinen statt. In der U-Bahn gibt es zum Beispiel extra Abteile für Frauen. Eine ganz andere Welt/Kultur die nur die nachvollziehen können, die hier aufgewachsen sind.
Wie enttäuschend muss es gewesen sein, dass sich der Vater so wenig Zeit für seine Tochter nahm, sie, oder auch ich als Leserin hatte mehr erwartet.
Während des Lesens musste ich oft an die Reise meiner Tochter nach Teheran zur Hochzeit der Schwester ihres Lebensgefährten denken, drei Tage wurde gefeiert, mit vielen, vielen Verwandten und Bekannten.
Gerne empfehle ich das Buch weiter.
Vor allem mag ich den ganz eigenen Schreibstil der viele Bilder im Kopf entstehen lässt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für