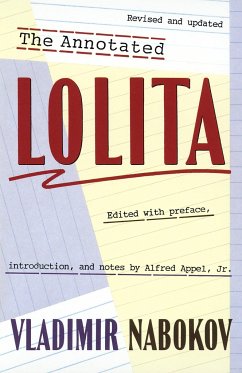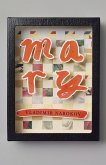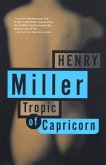Könnte Nabokovs berühmtes Buch über den Missbrauch eines Kindes heute noch so erscheinen? Eine Erstlektüre im Jahr von #MeToo
Fünf amerikanische Verleger hatten das Manuskript abgelehnt, dann kam Walter Minton, der junge Verleger von Putnam, und druckte "Lolita". Sechzig Jahre ist das jetzt her. Auf einer Party hatte Minton eine Revuetänzerin kennengelernt, auf deren Sofa er später eingeschlafen war, sie hieß Rosemary Ridgewell. Als er mitten in der Nacht wieder aufwachte, lag da auf dem Tisch Nabokovs Buch - in jener gekürzten Ausgabe, die drei Jahre vorher bei Olympia Press erschienen war, einem englischsprachigen Verlag für Erotika in Paris. Minton, so hat er es neulich dem "New Yorker" erzählt, las bis zum Morgengrauen - und er war fest entschlossen, dieses Buch zu drucken.
Er schrieb sofort einen Brief an Vladimir Nabokov, der seit 1940 in den Vereinigten Staaten lebte und als Professor an der Ivy-League-Universität Cornell in Ithaca russische und europäische Literatur unterrichtete. Nabokov war damals ein kaum bekannter Schriftsteller, die Familie war nach der russischen Revolution nach Westen geflohen, Nabokov studierte in Cambridge, lebte zeitweilig in Berlin, floh dann vor den Nazis nach Frankreich und weiter nach Amerika. Seit 1940 schrieb er nur noch auf Englisch. In einem Schneesturm flog Minton zu ihm nach Ithaca - und dann, als sie sich einig waren, auf dem Weg zur Frankfurter Buchmesse weiter nach Paris: um dem Verleger von Olympia Press, Maurice Girodias, die Rechte von "Lolita" abzuhandeln.
Das Buch wurde, in seiner Originalfassung, ein Welterfolg. Und ein Skandal. Und verfilmt, einmal von Stanley Kubrick, später dann mit Jeremy Irons in der Hauptrolle als Humbert Humbert: ein pädophiler, französischer Lehrer in Amerika, der eines Tages, durch Zufall, die zwölfjährige Dolores und deren Mutter kennenlernt, ins Haus der Familie Haze einzieht und die Mutter heiratet, um der Tochter nah zu sein.
Die Mutter entdeckt die pädophilen Neigungen ihres Mannes für ihre Tochter, stürzt aus dem Haus und läuft vor ein Auto. Humbert, verwitwet, nimmt das Mädchen, das gerade im Sommerlager ist, mit auf einen Roadtrip quer durch die Vereinigten Staaten, von Hotel zu Motel. Irgendwann ist er am Ziel, hat Sex mit dem Mädchen, Tag für Tag und so oft er will, er bezahlt sie auch dafür. Die Reise endet nach einem Jahr in Beardsley, wo Dolores kurz zur Schule geht. Die beiden brechen bald erneut auf, Richtung Westen, irgendwann wird Dolores krank, muss ins Spital, verschwindet von dort. Humbert, aufgelöst, verzweifelt, sucht und sucht und findet sie schließlich, drei Jahre später, da ist Dolores verheiratet und schwanger. Die beiden nehmen Abschied voneinander - und Humbert reist weiter und erschießt den Mann, zu dem Dolores gezogen war, nachdem sie aus dem Krankenhaus abgehauen war. Er wird von der Verkehrspolizei festgenommen, schreibt in der Haft jenen Text, aus dem "Lolita", der Roman, gemacht ist. Sein Arzt bringt ihn postum heraus: Denn Humbert stirbt am Ende, genau wie Dolores, die er Lolita nannte. Humberts wahren Namen erfährt man nie.
"Da war, ich schwör's, wirklich eine gelblichviolette Stelle auf ihrem holden Nymphettenschenkel, den meine mächtige, behaarte Hand massierte und langsam umfasste, und da sie nur sehr spärliche Unterkleidung trug, schien nichts meinen muskulösen Daumen daran zu hindern, die heiße Mulde ihrer Leisten zu erreichen." Es sind Stellen wie diese, die "Lolita" zum Skandal gemacht haben, in Ländern wie Südafrika war er verboten. "Mein stöhnender Mund - meine Herren Geschworenen - erreichte fast ihren bloßen Nacken, während ich die letzte Zuckung der längsten Ekstase, die Mensch oder Monster je zuteilwurde, an ihrer linken Gesäßbacke ausdrückte."
Mensch oder Monster: Den Menschen monströs gezeichnet zu haben, das Monster menschlich, wie es Nabokov getan hat, und dabei aber nicht aufzulösen, ob Humbert das eine oder das andere ist: Dieses Rätsel, das nur die Kunst so stellen und darstellen kann, beschäftigt bis heute das Publikum des Romans. War Nabokov ein Moralist? Oder ein kalter Voyeur eines unaussprechlichen Verbrechens? Oder macht er sein Publikum zu kalten Voyeuren eines unaussprechlichen Verbrechens? Oder ist es Nabokovs Verbrechen gewesen, das Unaussprechliche auszusprechen, es dem Franzosen Humbert in den Mund zu legen, "Lolita, Licht meines Lebens, Feuer meiner Lenden. Meine Sünde, meine Seele"?
Es ist ein Roman. Nichts davon, was hier geschieht, ist wirklich geschehen, und weil das, was geschieht, zudem Humbert Humbert aus seiner Sicht, mit seinem Gestaltungswillen, erzählt, sollte man erst recht nichts wörtlich nehmen - auch nicht, dass Humbert sich selbst zu "mindestens fünfunddreißig Jahren Haft wegen Vergewaltigung" verurteilen würde. Er schreibt das zwar - aber er nennt Dolores eben auch sein "Äffchen" und "Haustier" und "geistig ein widerwärtig konventionelles kleines Mädchen", und er nimmt ihr das Geld, das er für den Sex bezahlt, wieder weg. "Wie süß war es, ihr den Kaffee zu bringen und ihn ihr dann zu verweigern, bis sie ihre Morgenpflicht erfüllt hatte."
Nichts davon ist also wirklich geschehen - und doch macht der Roman aus den Vergewaltigungen einer Minderjährigen etwas, an dem man teilhaben kann, indem man davon liest, weil es sich ein Schriftsteller ausgemalt hat - so wie man mit Stevenson nach einer Schatzinsel suchen kann, ohne dass es den Schatz oder die Insel oder die Suche je gegeben hätte. Das war der Verdacht, der Skandal: dass hier ein Verbrechen idealisiert werden könnte, indem der Autor ein Kunstwerk daraus macht. "Ich schere mich nicht im Geringsten um öffentliche Moralbegriffe in Amerika und anderswo", hat Nabokov im Interview mit der "Paris Review" gesagt, und solche Sätze haben es sicher nicht einfacher gemacht.
"Die Freiheit der Kunst", hat die österreichische Schriftstellerin Eva Menasse vor ein paar Wochen gesagt, als sie das Internationale Literaturfestival Berlin eröffnete, ist "heute kleiner als noch vor wenigen Jahren." Und sie spitzte es auf ein Beispiel zu: "Heute wäre so gut wie undenkbar, dass Nabokovs ,Lolita' veröffentlicht werden könnte, eines der großartigsten Kunstwerke der Literatur, obwohl und weil es um einen detailliert beschriebenen Kindesmissbrauch geht." Schon 1955 habe es erhebliche Schwierigkeiten gegeben, das Buch zu drucken: "Heute bekäme Nabokov mindestens Morddrohungen."
Menasse sieht eine "pseudokorrekte Inquisition" am Werk, die per Shitstorm Künstlerinnen und Künstler verfemt: "Die eigenen Leute, das eigene Lager, an ihrer Spitze die ganz Jungen, verlieren ihre Liberalität, die Offenheit und Neugier und vor allem den Humor, den wir den Rechten früher voraushatten. Sie geben das auf zugunsten von Forderungen nach literarischer Säuberung, von Denk- und Redeverboten, die aus falsch verstandener, aus auf die Spitze getriebener Rücksichtnahme entstanden sind." Von "militanter Intoleranz" und einem "Tsunami der Vereinfachungen" spricht Menasse. Ein Roman wie "Lolita" habe in diesem Klima keine Chance mehr.
Das ist leider nicht überprüfbar, was aber man tun kann, ist, "Lolita" zu lesen - in meinem Fall zudem zum ersten Mal für diesen Artikel, und das also 2018, unter dem Eindruck einer öffentlichen Auseinandersetzung über sexuelle Gewalt, die seit einem Jahr unter dem Hashtag MeToo gebündelt wurde.
Und die Lektüre ergibt: "Lolita" ist ein Monument des weißen, alten Mannes, so wie er zur Chiffre geworden ist im Laufe dieser Auseinandersetzung - und allein deswegen gehört der Roman in die Bibliothek von #MeToo. Denn er zeigt, worum es im Kern bei dieser Bewegung immer gegangen ist: sichtbar zu machen, wie Machtverhältnisse sexuell ausgenutzt werden können. "Im Hotel hatten wir getrennte Zimmer", schreibt Humbert, "aber mitten in der Nacht kam sie herüber, und sehr sanft machten wir es wieder gut. Verstehen Sie, sie hatte sonst ja auch niemanden, zu dem sie hätte gehen können."
Im Original klingt es noch desolater: "You see, she had absolutely nowhere else to go", und diese Stelle ist nur eine von vielen, in denen Humbert vorführt, wer über wen verfügt. Hier rationalisiert er das sogar noch, "verstehen Sie", schreibt er, sie konnte ja nur in mein Bett, wohin sonst? Dass er es aber war, der sie obdachlos gemacht, der diese Situation erst herbeigeführt hat, so wie Harvey Weinstein die Schauspielerinnen zum Casting ins Hotelzimmer zitierte: Das sagt er nicht.
Wir sollen verstehen, ihn verstehen: "Lolita" ist das Psychogramm eines Täters, und das erzählerische Risiko, das Nabokov eingegangen ist, indem er die Tat von innen her zu beschreiben versucht, spürt man noch immer. Gerade ist in den Vereinigten Staaten ein Buch erschienen, "The Real Lolita" von Sarah Weinman, das von der elfjährigen Sally Horner erzählt, die 1948, exakt zur gleichen Zeit, in der Nabokov "Lolita" spielen lässt, von einem fünfzigjährigen Mann namens Frank La Salle entführt und über einundzwanzig Monate hinweg vergewaltigt wurde, bis sie um Hilfe rufen konnte. Nabokov spielt in seinem Roman sogar auf den Fall an, nennt Täter und Opfer beim Namen: Sarah Weinman will jetzt dem Mädchen, das zwei Jahre nach seiner Befreiung starb, in ihrem Buch die Biographie zurückgeben, die La Salle ihr geraubt hat - und in gewisser Weise auch Nabokov, dieser Vorwurf schwingt jedenfalls mit, weil der sich für seinen Roman beim Schicksal des Mädchens bedient habe.
Aber das tut auch Humbert Humbert, indem er Dolores erzählt: davon, wie sie in sein Bett kroch. Wie sie ihn verführt hat. Was das Publikum von Dolores weiß, weiß es nur von ihm. Wenn es bei #MeToo darum geht, die Opfer zu Wort kommen zu lassen, dann ist "Lolita" das komplette Gegenteil davon, und mehr noch: Der Täter schildert auch sein Opfer und entrechtet es damit ein weiteres Mal. Wir müssen, als Publikum, Humbert glauben, dass sie ihn zu Doktorspielen aufgefordert hat. Wir sind ihm auch darin ausgeliefert, sind abhängig von dem, was er uns gibt - ihre Tränen in der Nacht, ihr "nicht schon wieder!", wenn Humbert es schon wieder will.
Humbert, der über sich selbst zu Gericht sitzt, das ist der erzählerische Rahmen dieser Bekenntnisse, ist jederzeit im Vollbesitz dieser Erzählung. Sosehr er auch leidet, sosehr er sich selbst, in seiner Raserei und Verzweiflung und Geilheit, auch verachtet und diese Verachtung mit der Verachtung anderer, kleinerer Geister verbrämt: Er entscheidet, was er preisgibt. Eigentlich wissen wir gar nicht, was wirklich geschah, wir wissen nur, was Humbert uns zu wissen gegeben hat. Nabokovs "Lolita" ist ein Meisterwerk der Machtverhältnisse - auch der einer Figur über seine Leserinnen und Leser.
Aber die Jahre, die seit 1958 vergangen sind, haben aus dem Buch auch das verwitternde Denkmal eines abendländischen Bildungsideals und aller damit verbundenen Statusansprüche und -gewinne gemacht, und auch das trägt dazu bei, dass sich "Lolita" liest wie das Buch zur Diskussion: "Shorts, Büstenhalter mit wenig zum Halten, helles Haar - eine Nymphette, beim Pan!", ruft Humbert einmal beim Anblick eines kleinen Mädchens, und beim Pan, dieser Tonfall des klassischen Abendlandes trägt das ganze Buch! Einmal beschreibt Humbert eine junge Krankenschwester "with overdeveloped gluteal parts", andere (und die deutsche Übersetzung bei Rowohlt) sagen Hinterteil dazu - Humbert, der Vergewaltiger, aber ist sich zu fein dafür.
Diese Prätentionen, das Sendungsbewusstsein, das Bedürfnis, sich selbst im eigenen Vokabular immer wieder der eigenen Auserwähltheit zu versichern: Mag sein, dass Nabokov es gar nicht interessiert hat oder es sogar gegen seine Absichten geschieht; es ist ja zudem kurios, wie hier ein gebürtiger Russe auf Englisch einen Franzosen auf Englisch erzählen lässt, und zwar im erlesensten Englisch. Aber Humbert wirkt wie das Relikt einer Sprachmacht, die außer Kraft gesetzt wird - und zwar durch die Emanzipation jener Teile der Gesellschaft, die jetzt, endlich, auch mitreden wollen, damit alle gleichberechtigt reden dürfen.
Walter Minton, der Verleger, der sich traute, dieses Buch vor sechzig Jahren zu drucken, ist heute fünfundneunzig Jahre alt. Er hat zwar vor kurzem noch den "New Yorker" in seinem "Haus, das Lolita gebaut hat" empfangen, wie Nabokov es einmal genannt hat. Aber die Frage aus Deutschland, ob "Lolita" heute noch eine Chance hätte, beantwortet seine Tochter Jenny, die auch in der Buchbranche arbeitet: Sie bereite einen Band mit Essays vor, schreibt sie, "Lolita in the Afterlife", in der Autorinnen wie Sloane Crosley diese Frage beantworten - und die Regisseurin Sofia Coppola ein paar Szenen für ein Drehbuch über Lolita im 21. Jahrhundert schreiben soll. Das Buch zu drucken sei damals eine radikale Tat gewesen, sagt Jenny Minton, und heute wäre es das immer noch. Ihr Vater bestellt herzliche Grüße, die Frankfurter Buchmesse habe er immer geliebt.
TOBIAS RÜTHER
Vladimir Nabokov: "Lolita". Roman. Gesammelte Werke, Bd. 8, Rowohlt, 12 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main