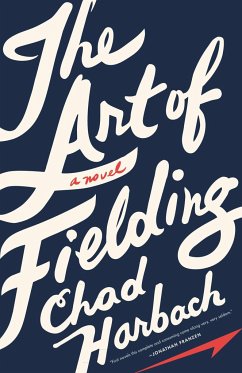Man muss Baseball nicht mögen, um diesen Roman zu lieben. Man kann dieses amerikanische Spiel, in dem scheinbar nicht viel passiert, sogar für einen langweiligen Zeitvertreib halten und trotzdem von diesem 600-Seiten-Wälzer mitgerissen werden. Obwohl sich in Chad Harbachs "Die Kunst des Feldspiels" vieles um Baseball dreht, geht die Geschichte weit übers Werfen, Fangen, Schlagen und Herumstehen hinaus: Sie handelt vom provinziellen College-Leben, vom Erwachsenwerden, von Liebe (auch gleichgeschlechtlicher), und vor allem behandelt sie Chancen, Risiken und Nebenwirkungen des Mannschaftssports im Allgemeinen. Von Freundschaften, wie sie der Sport stiften kann und gefährden. Vom Teamgeist und dessen Bedrohungen. Vom Athleten-Traum, im entscheidenden Wettkampf eine perfekte Leistung abzuliefern. Von Ausnahmekönnern, die an ihrem Talent zu zerbrechen drohen. Von Missbrauch von Schmerzmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln. Eingebunden in die Erfolgsstory des Collegeteams "Harpooners", das sich von einem Prügelknaben zum Meisterschaftsanwärter mausert, sind Sentenzen, die in ihrer Lakonie geradezu lehrhaft sind. Zum Beispiel jene über gutes Coaching, die sich auch Fußballtrainer wie Felix Magath an ihre Kabinentür heften können: "Ein guter Coach ließ jeden in der ihm gemäßen Weise leiden. Ein schlechter Coach ließ alle gleich leiden und war damit eher eine Art Folterknecht."
Leistungssport heißt Leiden. Das erfahren vor allem die beiden Freunde Henry, das schüchterne und schmächtige Supertalent, und Mike, sein Entdecker und verletzungsgeplagter Mitspieler. Als Henry, anfangs der Erfolgsgarant der "Harpooners", die Aufmerksamkeit sämtlicher Profi-Scouts und Berater erregt hat und unmittelbar davorsteht, einen amerikanischen College-Rekord zu übertreffen, versagt er kläglich. Jeder Wurf, zuvor traumwandlerisch ausgeführt, geht plötzlich daneben. Das Team, angeführt von Henrys Förderer Mike, steht vor einer Zerreißprobe: Soll es mit seinem Star, dem es fast alles verdankt, womöglich untergehen? Oder soll es dem Hochbegabten, der dem Druck offenbar nicht gewachsen ist, eine Zwangspause verordnen? Der Perfektionist, zumal der in sich gekehrte Henry, muss das Scheitern lernen. "Vielleicht war es nicht einmal Baseball, was er liebte, sondern nur diese Vorstellung von Perfektion, von einem ganz und gar einfachen Leben, in dem jede Bewegung zählte, und Baseball war nur das Medium, durch das er sein Ziel erreichen konnte." Solche Gedanken, solch eine Geschichte und so viel Weltgehalt in einem deutschen Roman über Fußball - auch das wäre eine Vorstellung von Perfektion.
kle.
Chad Harbach: "Die Kunst des Feldspiels". Roman aus dem Englischen von Stephan Kleiner und Johann Christoph Maass. Dumont Buchverlag, Köln 2012. 607 Seiten, 22,99 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main