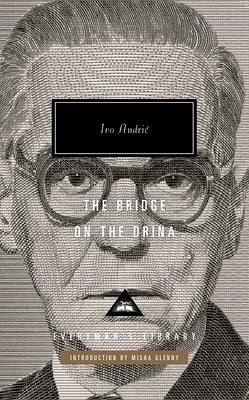
The Bridge on the Drina
Introduction by Misha Glenny
Übersetzer: Edwards, Lovett F

PAYBACK Punkte
11 °P sammeln!
"First published in 1945 as Na Drini Cuprija by The Prosveta Publishing"
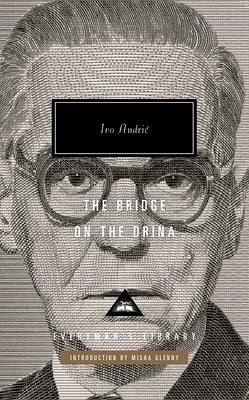
Introduction by Misha Glenny

Rechnungen
Bestellstatus
Retourenschein
Storno