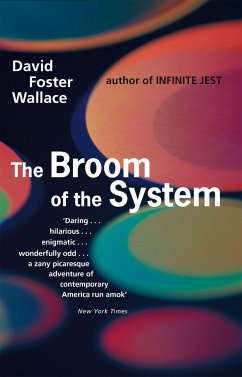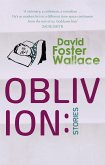Heimschläfer auf Höllenfahrt: Die Belletristik in diesem Herbst
Kurz und Gut steht jeden Morgen an der Ecke und erzählt. Man nennt ihn Kurz und Gut, weil er, ständig hustend und lungenkrank, nicht mehr ausreichend Luft für eine ausführliche Erzählung hat. "Also kurz und gut, sagte er dann: Viele kurze Geschichten ergeben auch eine lange, ist vielleicht auch interessanter." So rezitiert er wörtlich den Beginn von Dostojewskis "Idiot" und erzählt dann, kurz und gut, dessen Quintessenz in einem einzigen Satz. Dieser Kurz und Gut ist nur eine der unvergeßlichen Figuren in Dieter Fortes neuem Roman "Auf der anderen Seite der Welt" (S. Fischer), eine Gestalt wie ein orientalischer Geschichtenerzähler, der sich ins Nachkriegs-Düsseldorf verirrt hat. Wie alle diese Figuren ist er ein Führer in die Unterwelt. Zu Beginn des Romans reist der Erzähler, das Kind aus Fortes autobiographischer Trilogie "Das Haus auf meinen Schultern", ans Meer, in ein Lungensanatorium, eine Hadesfahrt ohne Wiederkehr. Fortes Buch ist eines der düstersten dieses Herbstes und zugleich eines der reichsten, eine postapokalyptische Version des "Zauberbergs", die die "Stunde Null" nicht als Tor zu hellen Wirtschaftswundertagen versteht, sondern als schwarzes Loch, das Vergangenheit wie Zukunft in seinen Sog reißt.
Höllenwanderungen, Schattenreiche, Grubenfahrten in die Stollen der Erinnerung - in diesem Herbst, in dem die Deutschen im Kino mit dem Führerbunker das dunkelste Verlies ihrer Geschichte betreten, ist auch die Belletristik voller Abstiege ins Inferno, allerorten Erkundungen dunkler Geschichtsflecken. Es ist kein Zufall, daß eine der interessantesten literaturwissenschaftlichen Neuerscheinungen, "Höllenfahrten" von Isabel Platthaus (Wilhelm Fink), die "Unterwelten der Moderne" von Joyce bis Pynchon ausmißt. Der Abstieg in die Unterwelt ist stets auch ein Blick in die Tiefe der eigenen Seele und die Untiefen der Vergangenheit.
"Da geht's gleich richtig in den Schacht", nennt das Lutz Schaper, eine der Hauptfiguren in Antje Rávic Strubels Roman "Tupolew 134", der auf einem authentischen Fall beruht: 1978 entführten zwei DDR-Bürger eine polnische Linienmaschine auf dem Rückflug nach Schönefeld und zwangen sie zur Landung in Tegel. Wie Strubel die bleierne Atmosphäre jener Jahre sinnlich heraufbeschwört und zugleich die Unmöglichkeit einer authentischen Rekonstruktion der Vergangenheit demonstriert, ist virtuos. Der "Schacht" wird dabei zur zentralen Metapher der Erinnerung, immer wieder geht es nach "ganz unten", wo die Grenzen der Dinge und alle Gewißheiten verschwimmen.
Nicht nur für DDR-Bürger war West-Berlin ein Sehnsuchtsort. Auch mancher bundesrepublikanischer Wehrpflichtiger entzog sich so der Einberufung. Der zweite Roman von Sven Regener "Neue Vahr Süd" (Eichborn) liefert die Vorgeschichte seines Herrn Lehmann nach, der in den frühen Achtzigern nahe bei Bremen zum Bund muß. "Die ihr antretet, laßt alle Hoffnung fahren" könnte hier über dem Kasernentor stehen. Regener liefert die burleske Variante der Höllenfahrt, die immer pünktlich am Wochenende unterbrochen wird. Doch als Heimschläfer kann er nicht sicher sein, ob seine versifftes WG-Zimmer nicht in Wahrheit der allerunterste Kreis der Hölle ist.
Das gleiche gilt für jenen diabolischen Sexclub namens "Klapsmühle", den Abel Nema in Terézia Moras erstem Roman "Alle Tage" (Luchterhand) betritt und nur nackt und zerschunden wieder verläßt. Schlagender als durch Moras grandioses Panorama unserer Epoche der Fluchten und Vertreibungen mit seiner Vielzahl faszinierender Figuren und Geschichten läßt sich das Motto von Kurz und Gut nicht beweisen. Eine ähnliche Stoffülle bietet Thomas Brussig in "Wie es leuchtet" (S. Fischer) auf. Doch der vermeintlich ultimative Wenderoman demonstriert, daß allein die Addition von Episoden noch lange kein Zeitpanorama macht.
Die "Ästhetik des Widerstands" von Peter Weiss ging ja aus dem Plan hervor, Dantes "Commedia" für das zwanzigste Jahrhundert zu schreiben. Der dunkelste Schreckensort war hier Plötzensee, die Schlachtstätte der Hitler-Attentäter. F. C. Delius erinnert in "Mein Jahr als Mörder" (Rowohlt Berlin) an das Schicksal des Widerständlers Georg Groscurth, der im Mai 1944 mit dem Fallbeil hingerichtet wurde und dessen Sohn ein Kindheitsfreund des Autors war. Als 1968 der NS-Richter freigesprochen wird, faßt der Erzähler den Entschluß zur Selbstjustiz. An '68 arbeiten sich gleich mehrere Generationen ab: Gerhard Seyfried, Jahrgang 1948, stellt sich noch einmal unter den "Schwarzen Stern der Tupamaros" (Eichborn), Sophie Dannenberg, geboren 1971, klagt im Namen der unter Spätfolgen leidenden Kinder "Das bleiche Herz der Revolution" an (DVA), und Peter Rühmkorf (1929) veröffentlicht seine Tagebücher 1971/72 (Rowohlt).
Wer hierzulande familiengeschichtliche Grabungen anstellt, stößt irgendwann immer auf eine Kammer des Schreckens. Martin Pollack forscht seinem Vater nach, einem später wohl von Partisanen 1947 ermordeten SS-Offizier und Kriegsverbrecher ("Der Tote im Bunker", Zsolnay). Jakob Hein dagegen erinnert sich anrührend an seine verstorbene Mutter und erkundet dabei die jüdischen Wurzeln der Familie im Dritten Reich ("Vielleicht ist es sogar schön", Piper). Auch einige der wichtigsten Übersetzungen sind Familienromane, doch wer hier angesichts der Titel Erbaulicheres erwartet, täuscht sich: Über der "Liebe" in Toni Morissons gleichnamigem Roman (Rowohlt) scheint ein Fluch zu liegen; in Amoz Oz' gewaltiger "Geschichte von Liebe und Finsternis" (Suhrkamp) droht den knapp den europäischen Schrecken entronnenen Juden in Palästina erneut die Vernichtung. Daß der Amerikaner Denis Johnson nicht allzu optimistisch in die Welt blickt, ist aus seiner Novelle "Train Dreams" (Mare) in aller Konzentration abermals zu erfahren. Endlich übersetzt wurde "Der Besen im System", der hintersinnig-irrsinnige Debütroman des genialischen David Foster Wallace (Kiepenheuer & Witsch). Im Osten Europas taugt der Fortschritt schon lange nur noch als Groteskenstoff. Der Tscheche Péter Zilahy blickt in seinem verspielten "Revolutions-Alphabet" "Die letzte Fenstergiraffe" (Eichborn) mit Kinderblick auf das ehemalige Jugoslawien. Viktor Pelewin stellt in "Die Dialektik der Übergangsepoche von Nirgendwoher nach Nirgendwohin" (Luchterhand) den ganzen postkommunistischen Aberwitz Rußlands bloß. "Das jetzige System nannte sich Fortschritt, drehte sich aber Schritt für Schritt nur im Kreis, was natürlich keiner bemerkte, es ging ja immer so schön geradeaus", so heißt es bei Forte.
Nicht nur die deutsche Literatur also hat jeden Glauben an Fortschritt und Vervollkommnung längst aufgegeben. Das bevorstehende Schiller-Jahr dürfte spannend werden: Zwar ist Schiller ja selbst vor allem in seinen Briefen "Über die ästhetische Erziehung" der schärfste Fortschrittskritiker gewesen, hatte aber doch mit allem Pathos die Kunst als Remedium inthronisiert. Vielleicht ist ja der "ästhetische Zustand", als Harmonie von Sinnlichkeit und Vernunft, gar nicht so weit weg von Pelewins buddhistischer Weltentrücktheit. Neben neuen Werkausgaben erscheinen zwei Biographien: Während Sigrid Damm (Insel) eher das Private erkundet, nimmt Rüdiger Safranski (Hanser) eine ambitionierte Rekonstruktion des Schillerschen Idealismus vor.
Und wo versteckt sich in der Gegenwart das Positive? Natürlich in der literarischen Form - und in der Liebe, die ja auch nur eine Funktion der Sprache ist. Marion Poschmanns Buch "Grund zu Schafen" (Frankfurter Verlagsanstalt) ist einer der wichtigsten Gedichtbände der letzten Zeit und markiert die Rückkehr einer Naturlyrik auf höchstem Sprach- und Reflexionsniveau. Diese in wunderbaren, manchmal zunächst dunklen, dann blitzartig klaren Sprachbildern eingefangene Natur erobert sich auch hier die resignierende industrielle Zivilisation zurück. Und wo die Biologie kein Rätsel mehr offenläßt, muß die Sprache die Welt ins Wundersame und Märchenhafte überführen.
Ein Programm, das auch die große Naturerzählerin Brigitte Kronauer unterschreiben würde. Sie hat mit "Verlangen nach Musik und Gebirge" (Klett-Cotta) einen ausgelassenen, entrückten Liebesverwirrungsroman geschrieben. Wie bei Forte beginnt das Buch mit einer seltsamen Reise ans Meer, nach Oostende. Und wenn man diese beiden Zugfahrten nacheinander liest, dann hat man fast schon das ganze Spektrum dieses Herbstes aufgefächert.
RICHARD KÄMMERLINGS
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main