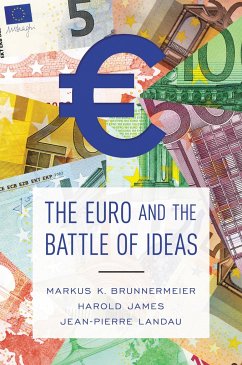Why is Europe's great monetary endeavor, the Euro, in trouble? A string of economic difficulties in Greece, Ireland, Spain, Italy, and other Eurozone nations has left observers wondering whether the currency union can survive. In this book, Markus Brunnermeier, Harold James, and Jean-Pierre Landau argue that the core problem with the Euro lies in the philosophical differences between the founding countries of the Eurozone, particularly Germany and France. But the authors also show how these seemingly incompatible differences can be reconciled to ensure Europe's survival. As the authors demonstrate, Germany, a federal state with strong regional governments, saw the Maastricht Treaty, the framework for the Euro, as a set of rules. France, on the other hand, with a more centralized system of government, saw the framework as flexible, to be overseen by governments.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

In der Währungsunion prallen unterschiedliche Wirtschaftskulturen aufeinander
Die Krise der europäischen Einheitswährung, die den Kontinent seit Jahren in Atem hält, hat ihre Ursache nicht einfach in südländischem Schlendrian oder der moralischen Verachtung des Schuldenmachens, die Nordeuropäern nachgesagt wird. Der Geburtsfehler des Euros bestand in der Annahme, man könne die zunächst elf, heute 19 Nationalstaaten der Währungsunion in einem System unveränderlicher Wechselkurse zusammenfassen und negative Folgewirkungen durch kluge institutionelle Arrangements und Verhaltensregeln im Griff behalten.
Dem stand von Anfang an die Tatsache entgegen, dass die Mitglieder der Währungsunion sich in ihren kulturellen und politischen Traditionen, in den vorherrschenden Mentalitäten, Denkweisen und Praktiken zum Teil beträchtlich voneinander unterscheiden. Als wesentliche Zutaten der toxischen Mischung von Krisenelementen haben Markus Brunnermeier, Harold James und Jean-Pierre Landau die gegensätzlichen Wirtschaftsphilosophien ausgemacht, die in Europas Norden (vor allem in Deutschland) und im mediterranen Süden (vor allem in Frankreich) vorherrschen. Die Malaise des Euros sei deswegen so hartnäckig, lautet die These ihrer 2016 auf Englisch erschienenen und jetzt in deutscher Übersetzung vorliegenden Studie, weil aufgrund unterschiedlich vorgeprägter nationaler Denkweisen weder über die Ursachen der Probleme noch über mögliche Auswege und wünschenswerte Zukunftsszenarien Einigkeit zu erzielen sei.
Die föderale Tradition Deutschlands sieht ein verbindliches Regelwerk als Rahmen der Konfliktaustragung in einem heterogenen Gemeinwesen vor. Frankreichs zentralstaatliches Erbe präferiert die Flexibilität und Handlungsfähigkeit einer starken Exekutive im Dienste des Allgemeinwohls. Für die ordoliberale Schule der deutschen Volkswirtschaftslehre ist der Grundsatz der Haftung wichtig. In der französischen Denkweise bleibt die revolutionäre Parole der Solidarität der Starken für die Schwachen bestimmend.
Französische Ökonomen interpretieren die Schulden von Banken oder Staaten eher als vorübergehende Liquiditätsprobleme, die durch Interventionen des Staates überwunden werden können. Ihre deutschen Kollegen tendieren dazu, die Solvenz der betreffenden Institute oder Länder in Frage zu stellen. Daraus ergeben sich in Krisensituationen gegensätzliche Handlungsempfehlungen: im deutschen Fall für Sparmaßnahmen, um grundlegende Verhaltensänderungen zu bewirken; aus französischer Sicht gegen scharfe Einschnitte, die Liquiditätsschwierigkeiten angeblich verschlimmern und tatsächliche Insolvenzen erst herbeiführen.
Die angloamerikanische Mehrheitsmeinung schenkt Haftungsfragen weniger Aufmerksamkeit, veranschlagt die Gefahren des moral hazard geringer und fordert in Krisenlagen das tatkräftige Eingreifen des Staates. Sie liegt damit in wichtigen Streitfragen der Euro-Krise näher bei der französischen als bei der deutschen Position. Das erklärt, warum die diskursbestimmende Wirtschaftspresse englischer Sprache vom "Wall Street Journal" über die "New York Times" bis zum "Economist" und der "Financial Times" kaum Sympathien für deutsche Bedenken aufbringt.
Das Autorengespann - ein seit Jahren in den Vereinigten Staaten arbeitender deutscher Ökonom, ein ebenfalls in Amerika forschender britischer Wirtschaftshistoriker und ein ehemaliger Vizepräsident der Französischen Nationalbank, der Wirtschaftswissenschaften in Paris lehrt - ist klug genug, die eigenen Vorprägungen zu reflektieren. Zugleich machen die Verfasser deutlich, dass keine der nationalen Positionen frei von Aporien und Ungereimtheiten ist.
Die Pariser Forderung nach einer aktiv intervenierenden europäischen Wirtschaftsregierung mit beträchtlichen eigenen Geldmitteln passt schlecht zur traditionellen französischen Weigerung, Budgetbefugnisse oder andere nationalstaatliche Kompetenzen nach Brüssel zu übertragen. Die übliche rhetorische Begeisterung der deutschen Politik für "mehr Europa" im Sinne supranationaler Lösungen stößt an Grenzen, wenn es darum geht, Eurobonds oder andere Varianten einer förmlichen Vergemeinschaftung von Schulden offen ins Werk zu setzen, statt die Finanztransfers auf dem Umweg über die EZB stillschweigend geschehen zu lassen.
Die britische Politik erkannte früher als andere, dass eine Währungsunion ohne Fiskalunion nicht funktioniert. Sie schloss zugleich aus, sich an weiteren Vertiefungen der EU zu beteiligen. Mit dieser Sichtweise lag London näher bei Washington als bei Berlin oder Paris. Die Briten wurden aber (vor Trump) von Amerika gedrängt, daraus nicht die Konsequenz zu ziehen und aus der EU auszuscheiden: "Je größer die Bereitschaft Großbritanniens wurde, Europa existentiell herauszufordern, desto distanzierter wurden die Vereinigten Staaten."
Trotz des eher düsteren Befundes enden Brunnermeier, James und Landau auf einer optimistischen Note. Sie plädieren für eine "Union der ökonomischen Ideen" und glauben an die Chance, nationales Denken zu überwinden. Es sei möglich, eine "optimale Balance" zwischen deutschen und französischen Standpunkten zu finden. Gerade die Fülle der Krisen eröffne die Möglichkeit von Paketlösungen und Tauschgeschäften, etwa durch die Verknüpfung der Schuldenthematik mit dem Flüchtlingsproblem.
Zuversicht ziehen die Autoren aus der Tatsache, dass Wirtschaftskulturen nicht statisch seien, sondern sich rasch und drastisch ändern könnten. So sei Deutschland im 19. und frühen 20. Jahrhundert staatsgläubig, Frankreich hingegen wirtschaftsliberal gewesen, mit einer Politik des laissez faire und dem Vertrauen auf die disziplinierende Wirkung des Goldstandards. Die Rollenverteilung habe sich erst unter dem Eindruck der Katastrophe des "Dritten Reiches" geändert, die Deutschland und Frankreich gegensätzlich interpretierten: "Daraus lernten die Deutschen, dass sie Regeln brauchten, um staatliche Willkür zu beschränken, während die Franzosen zu dem Schluss kamen, ihr politisches System unter der Dritten Republik habe auf die Bedrohung durch die Nazis fiskalisch, militärisch und intellektuell nicht hinreichend flexibel reagiert."
Die These ist originell. Sie passt jedoch kaum zu anderen Passagen des Buches, die zeigen, dass die Wirtschaftsphilosophien weiter zurückreichen als 1945: bis zu Colberts Verwaltungsstaat im Frankreich des 17. Jahrhunderts, dem Mehrebenensystem des Alten Reiches in Mitteleuropa, dem militärisch-fiskalischen Staat in England nach der Glorreichen Revolution von 1688 und der Übernahme der im Unabhängigkeitskrieg aufgehäuften Schulden durch die amerikanische Bundesregierung unter Alexander Hamilton.
Man darf bezweifeln, dass die gegenwärtigen Turbulenzen das Selbstverständnis der europäischen Nationen so gründlich umkrempelt, wie es die NS-Tyrannei getan hat. Im Gegenteil, es steht zu befürchten, dass im "Kampf der Wirtschaftskulturen" heute jede Seite ihre eigenen Vorannahmen bestätigt sieht und existierende Unterschiede weiter zementiert werden.
DOMINIK GEPPERT
Markus Brunnermeier, Harold James, Jean-Pierre Landau: Euro. Der Kampf der Wirtschaftskulturen.
C.H. Beck Verlag, München 2018. 525 S., 29,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main