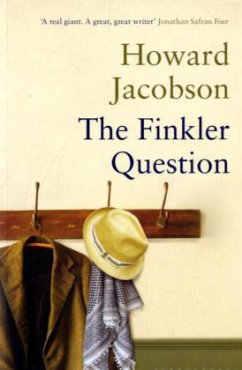Wer kennt den Briten Howard Jacobson? Nicht nur, weil er den Booker-Preis gewonnen hat, sollte man "Die Finkler-Frage" unbedingt lesen: Der Roman ist großartig komisch und klug.
Anders als die amerikanische hat die britische Literatur keine ausgeprägt jüdische Romantradition, obwohl es, von Anita Brookner über Stephen Fry oder Zoe Heller bis zu Harold Pinter, durchaus nicht an Autoren fehlt. Es war der junge amerikanische Schriftsteller Jonathan Safran Foer, der im vergangenen Jahr auf diese Lücke hinwies: Hätte Howard Jacobson seine bisherigen Romane statt in Großbritannien in den Vereinigten Staaten verfasst, so Foer, wäre er dort inzwischen einer der ganz Großen und würde in einem Atemzug genannt werden mit Saul Bellow und Philip Roth, und, wie man hinzufügen darf, auch Safran Foer selbst.
Aber Howard Jacobson, der nach eigenem Bekunden "lieber die jüdische Jane Austen als der englische Philip Roth" sein möchte, ist eben kein amerikanischer Schriftsteller - und als Leser kann man nur sagen: zum Glück. Denn es ist schon sehr lange her, dass Philip Roth so witzig, sarkastisch und selbstironisch über das Mann- und Judesein geschrieben hat wie Howard Jacobson in seinem Roman "Die Finkler-Frage". Im vergangenen Herbst wurde er dafür mit dem Booker-Preis belohnt; mit achtundsechzig Jahren war der Autor aus Manchester damit nach William Golding der zweitälteste Autor, dem die begehrte Ehrung bislang zuteilwurde. Jetzt endlich liegt der Roman auch auf Deutsch vor.
Der Held von "Die Finkler-Frage" heißt Julian Treslove und hat eigentlich nur eine große Begabung, und das ist die, in Tragik zu schwelgen. Bisher bestand sein einziges Unglück allerdings darin, dass sein Leben in den bisher fünfzig Jahren zur ausgeprägter Schwermut wenig Anlass gegeben hat, trotz vieler gescheiterter Beziehungen und einem Rauswurf bei der BBC. Denn Julian, für den Sehnsucht und Melancholie unbedingt zusammengehören, träumt von höherem Unglück: "Der vorzeitige Tod einer schönen Frau - gab es etwas Poetischeres?"
Auf der Suche nach einer Frau, die melodramatisch in seinen Armen dahinsiecht, ist seine Verliebtheitsbereitschaft grenzenlos, ihre Wirkung auf das andere Geschlecht jedoch begrenzt, und so hat Julian es mit seinem selbstdiagnostizierten Ophelia-Komplex lediglich zu zwei Söhnen von zwei Frauen gebracht, die allesamt noch sehr lebendig sind. Die Erfahrung, zu der er sich berufen fühlt, machen derweil andere, nämlich seine beiden Freunde Libor Sevcik und Samuel Finkler. Nicht genug damit, dass beide frisch verwitwet sind, haben sie Julian noch etwas voraus: Sie sind Juden, wie widerstrebend und kritisch auch immer - und besitzen damit für Julians neidvolle Auffassung ganz ohne eigenes Zutun eine der Tragik beneidenswert benachbarte Identität.
Just als er von einem Abendessen mit Libor und Sam kommt und diesen Gedanken noch gar nicht richtig zu Ende gedacht hat, fällt Julian einer denkwürdigen Raubattacke zum Opfer - die vielleicht, vielleicht auch nicht antisemtisch motiviert war. Julian ist geradezu hysterisch davon überzeugt, dass die Frau, die ihm Portemonnaie, Uhr und Füller abgenommen hat, ihn dabei als "Du Jud!" beschimpft hat. Darf, wer solches zu erdulden hatte, denn nicht auf Sympathie von Seiten derer rechnen, in deren Namen er verunglimpft wurde? Endlich scheint der Nichtjude, Nichtvater, Nichtredakteur und Nichtfrauenheld, den man als Doppelgänger von berühmten Schauspielern für Partys mieten kann, auf seiner Suche nach einer deutlichen Identität, einem Zugehörigkeitsgefühl im richtigen Leben angekommen.
Fortan will Julian Treslove nur noch eines: so jüdisch werden, wie er sich schon lange fühlt und wie es einem Goi nur möglich ist. Seine Freunde betrachten diese Bemühungen mit Spott und zunehmender Sorge. "Du weißt nämlich nicht, was du bist, und deshalb willst du Jude sein", sagt Sam Finkler. "Demnächst trägst du noch Schläfenlocken und sagst mir, dass du dich freiwillig zur israelischen Armee gemeldet hast, um Kampfjets gegen die Hamas zu fliegen. Das ist nicht gesund."
Dabei ist Samuel Finkler, dessen Nachname Julian seit Schultagen als Synonym für alles Jüdische gilt, eigentlich mehr sein Rivale als sein Freund: Nicht nur hatte er eine wunderschöne, kürzlich tragisch verstorbene Frau, sondern er hat es als Autor von populärphilosophischen Ratgebern zu Fernsehruhm und Geld gebracht, und die von ihm begründete israelkritische Initiative "ASCHandjiddn" trifft sich jede Woche im Groucho Club. Finkler, für den es "kein Israel, nur Palästina" gibt, ist ein ausgemachter "Schamjude", während der neunzigjährige Libor, der als Einziger seiner Familie die Schoa überlebt hat, die "Rettungsboothaltung" einnimmt: "Nein, ich war nie dort und will auch nicht hin. Doch mag selbst in meinem Alter der Tag nicht fern sein, an dem ich nirgendwo anders mehr hin kann. Das lehrt uns die Geschichte."
Während die politischen Fetzen zwischen den Freunden fliegen, sitzt Julian als "Schweinchen in der Mitte" dazwischen. Doch kaum, dass er sich als Opfer des antisemitischen Angriffs und damit bereits ein bisschen als Jude legitimiert fühlt und schon mit dem Gedanken an Hebräischstunden spielt, trifft er Hepzibah Weizenbaum, die sich seiner mit der ganzen erotischen und seelischen Kraft ihres weiblichen "Finklertums" annimmt. Julian ist außer sich vor Dankbarkeit und Bestätigung - und Hepzibah, die ein Londoner Museum für anglo-jüdische Kultur ins Leben ruft und Julian prompt zum Ko-Kurator ernennt, zunächst angetan, doch zusehends befremdet von seinem Eifer: "Richtige Juden mussten leiden für ihr Leid, doch dieser Julian Treslove meinte, er könne aufs Karussell hüpfen, wann immer ihm danach war, und dürfe sich auf Anhieb schlecht fühlen."
Es wird viel geredet in diesem Roman, und wie Jacobson seine temperamentvollen, fuchtelnden Charaktere dabei zu sprachverliebtem Leben kommen lässt, gehört zur Kunst, aber auch zur souveränen Lässigkeit dieses Romans, der seine akute Beunruhigung über eine gesellschaftliche Entwicklung, bei der nicht nur in Großbritannien Antizionismus immer häufiger in Antisemitimus überzugehen scheint, in zärtlichen, bisweilen auch wütenden Witz packt.
"Die Finkler-Frage" ist eine hochkomische, intelligente und aufschlussreiche Tragikomödie über Philo- und Antisemitismus, über jüdischen Selbsthass und gefährlich übertriebenen Zionismus. Von dem Sprachwitz des englischen Originals ist trotz Bernhard Robbens zuverlässiger Übersetzung im Deutschen einiges verloren gegangen, angefangen mit dem plakativsten Beispiel: "ASCHandjiddn" sind nun mal eine deutliche harmlosere Variante der "ASHamed Jews" im Englischen. Dass Julian Treslove am Ende Opfer seiner eigenen Sehnsüchte wird, ist nur eine der vielen bitteren Lektionen dieses wichtigen Werks.
"Die Finkler-Frage" ist Howard Jacobsons elfter Roman, und das einzige Buch, das von ihm in deutscher Übersetzung überhaupt lieferbar ist. Schön wäre es, wenn nun auch frühere Romane dieses dringend zu entdeckenden Autors, wie "The Act of Love" und "Kalooki Nights", ihren Weg über den Ärmelkanal fänden.
FELICITAS VON LOVENBERG.
Howard Jacobson: "Die Finkler-Frage". Roman.
Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2011. 436 S., geb., 22,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main