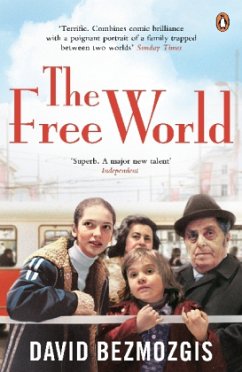Willkommen in Rom. Es ist der Sommer des Jahres 1978 und die Krasnansky Familie, zerstritten, müde und verwirrt, wartet neben tausenden von anderen sowjetischen jüdischen Flüchtlingen - unter ihnen Kriminelle, Dissidenten und Kriegsdienstverweigerer, auf ihre Passage in eine neue Heimat. Doch als ihr Gönner in den USA sie im Stich läßt, stecken sie fest. Willkommen also im Warteraum des Lebens und zu einer tragischkomischen Geschichte von rücksichtslosen Brüder und langmütigen Schwestern, kranken Eltern und unschuldigen Kindern und ihrer epischen Suche nach einem Zuhause: irgendwo und überall.

Mit liebevoller Ironie begleitet David Bezmozgis eine russische Familie auf dem Weg ins kanadische Exil
Es könnte die Geschichte von David Bezmozgis eigener Familie sein: 1978 erhält die achtköpfige jüdische Familie Kransnansky endlich ihre Ausreisegenehmigung. Sie stammt aus Riga und trifft im Juli, nach demütigenden Grenzschikanen, in Rom ein. Auch der 1980 im lettischen Riga geborene Filmemacher und Schriftsteller David Bezmozgis wanderte als Kind mit seiner Familie aus der Sowjetunion aus, und seine eigenen Erfahrungen spiegeln sich in der zärtlichen Genauigkeit, mit der er nicht nur seine heimatlos gewordenen Figuren schildert, sondern auch die problematische Heimat, die sie gerade verloren haben. Von Juli bis November, bis sie nach Kanada aufbrechen können, leben die acht in einem Provisorium, in dem jeder einer schonungslosen Inventur unterzogen wird: Können und Leidenschaften, Familiengefühle und Hoffnungen müssen sich an einem Nullpunkt der Existenz beweisen und neu ordnen - ein exemplarisches Schicksal. Es ist eindrucksvoll, wie lebensklug und liebevoll ironisch dieses Debüt von seelischen Irrwegen erzählt.
Scheinbar beiläufig beschreibt Bezmozgis die Angst und Unsicherheit, den Zorn und die Schuldgefühle seiner Figuren, während sie durch Rom und den nahen Badeort Ladispoli irren - das Zentrum des russischen Exillebens. Bei der fast hoffnungslosen Suche nach einer günstigen Wohnung oder mitten im Kampf um einen Platz auf dem Flohmarkt, um die mitgebrachten Ballettschuhe und Schallplatten zu verkaufen, verfangen sie sich immer wieder in ihren Erinnerungen. Die Sehnsucht nach den zurückgelassenen Verwandten wird in diesen Sommerwochen qualvoll körperlich: in jedem beobachteten Alltagsritual spüren sie die eigenen Verluste und trauern der zwar mangelhaften und grauen, aber vertrauten Welt nach.
Dabei schelten sie sich selbst für ihre "pathologischen" Gefühle. Jeder hadert auf seine ganz spezielle Weise mit der Entwurzelung, was ganz nebenbei ein vielschichtiges Bild der sowjetischen Gesellschaft ergibt: Samuel, der hochdekorierte Kriegsveteran und Parteifunktionär, wirft sich vor, seine Hoffnungen und seinen Glauben verraten und den geliebten, im Krieg gefallenen Bruder endgültig verlassen zu haben. Seine Frau Emma tröstet sich mit der Vorstellung, sie seien einfach wieder evakuiert worden, wie damals im Krieg. Dagegen trifft ihren Sohn Alec, der in jeder attraktiven Frau ein zu ergründendes Geheimnis sieht, in einem Pornokino die erschütternde Erkenntnis, dass es in seinem bisherigen Leben weder Lust noch Phantasie gab.
Durch eine Nebentür lässt der Autor sehr geschickt das Problem ihres jüdischen Selbstgefühls auftreten: Aus Langeweile besuchen sie öfter den jüdischen Klub, und während die Kinder begeistert jüdische Lieder lernen und die Frauen der Familie sentimental auf die kaum bekannten Rituale reagieren, gewinnt Samuel einen letzten Freund. Der invalide, unverbesserlich optimistische Geiger Roidman, der eine Oper über seine Großtante, die Lenin-Attentäterin Fanny Kaplan, komponiert, erklärt, er habe während der Monate in Italien mehr über die Sowjetunion erfahren als in seinem ganzen dortigen Leben.
In ihren lakonischen, großartig beschriebenen Streitgesprächen tut sich Samuel schwer mit seiner Selbstgerechtigkeit - und wirkt immer sympathischer. Er denkt an die Pogrome im Schtetl seines Großvaters zurück und hört wieder das leise Stöhnen seines Vaters, während die "Weißen" ihn erschlagen. Die Intensität und Lebendigkeit seiner Erinnerungen erschreckt ihn, und als er seine Lebensgeschichte zu schreiben beginnt, besuchen ihn Mutter und Bruder im Traum, redselig und gealtert, als wären sie nie gestorben. Er ist stolz auf seine sowjetischen Orden - die ihm, der "verlogenen Judenvisage", der Zöllner an der Grenze höhnisch abnahm - und steht zu seinen Missetaten (seinen zionistischen Cousin hatte er denunziert). Voll wütender Scham leiht er sich von Roidman dessen Orden, um trotz seiner schlechten Gesundheit ein Visum für Kanada zu bekommen. Aber was hatten er und Emma schon zu erwarten?, kommentiert er bitter: "Sie waren überholt, eine Wanderausstellung der Aussichtslosigkeit: Stalins verlorene Juden, die das Rendezvous mit dem Tod mehrmals überlebt hatten."
Das empfinden seine Söhne, die gegen Samuels Willen auf der Auswanderung bestanden, ganz anders: Sie stürzen sich in die kapitalistische Welt, der eine, um Geschäfte zu machen, der andere, um die freie Liebe zu genießen. Alec zerstört damit fast seine Ehe, wehrt sich aber mit lebenslang eingeübter Ironie gegen jede Verantwortung: In der Sowjetunion war Spott für ihn die einzig angemessene Art, dem sowjetischen Selbstüberschätzungspathos zu begegnen.
Der Konflikt zwischen Vater und Söhnen wird hart und mit viel Bitterkeit ausgetragen, denn jeder der (früher sehr erfolgreichen) Familie steckt in seinen Beschädigungen und Demütigungen fest wie in einem eigenen kleinen Kosmos. Polina beispielsweise, Alecs junge Ehefrau, wird von den sachlich-kühlen Berührungen des Amtsarztes in die traumatischen Empfindungen während ihrer zwei Abtreibungen zurückgeschleudert, eine wortlose, körperliche Verzweiflung, die Alec nicht versteht. Doch der erstaunlichste Fall ist Emma, die in der Fremde zu einer panischen und hilflosen Schein-Glucke mutiert, während sie als Medizinerin in Riga noch klug und selbstbewusst die Familiengeschicke lenkte. An ihrer Wandlung zeigt sich die seelische Gebrochenheit der Exilanten, die diese auf anrührende Weise zu verbergen suchen, besonders krass.
Letztlich zeigt Bezmozgis Mitleid mit seinen Figuren, denn sie haben Glück mit ihren Bekanntschaften im Schlangennest der russischen Community. Der Moldawier Ljowa, der Alec und Polina als Untermieter aufnimmt, ist ein Seelenverwandter des Schlehmil, des jüdischen Narren und Weisen, der sie Bescheidenheit und selbstbewussten Pragmatismus lehrt. Von Israel, wo er als Offizier gelebt hat, rät er ab: "Bis jetzt war ich Bürger von zwei Utopien. Heute sind meine Erwartungen bescheiden. Im Grunde möchte ich in das Land mit den wenigsten Paraden." Von der Ankunft in Kanada erzählt der Roman nicht mehr, davon handelte Bezmozgis vielfach preisgekrönter Erzählungsband "Natascha" .
NICOLE HENNEBERG
David Bezmozgis: "Die freie Welt". Roman.
Aus dem Englischen von Silvia Morawetz. Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln 2012. 350 S., geb., 22,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main