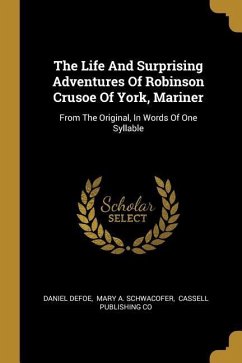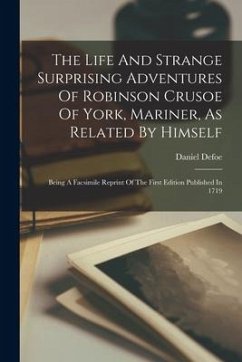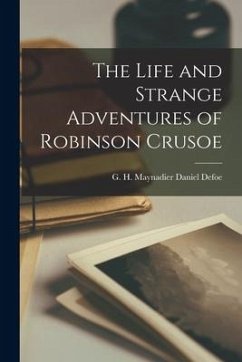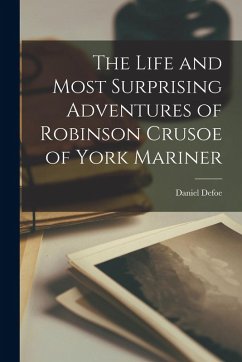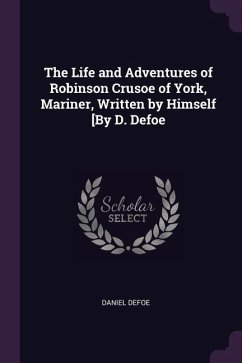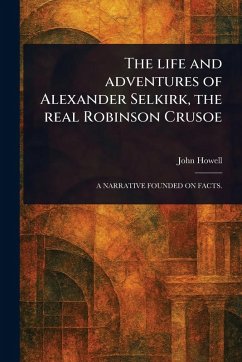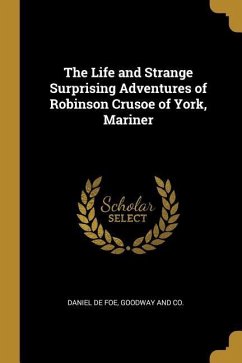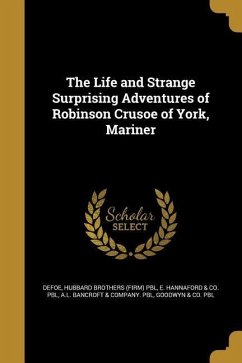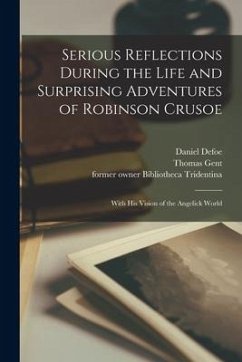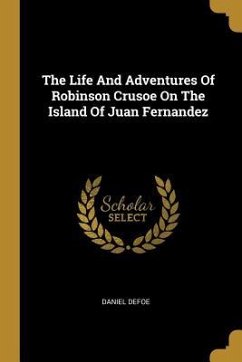
Daniel Defoe
Broschiertes Buch
The Life And Adventures Of Robinson Crusoe On The Island Of Juan Fernandez
Versandkostenfrei!
Versandfertig in über 4 Wochen

PAYBACK Punkte
10 °P sammeln!



The Life And Adventures Of Robinson Crusoe On The Island Of Juan Fernandez
Produktdetails
- Verlag: Creative Media Partners, LLC
- Seitenzahl: 220
- Altersempfehlung: 8 bis 12 Jahre
- Erscheinungstermin: 27. März 2019
- Englisch
- Abmessung: 234mm x 156mm x 12mm
- Gewicht: 313g
- ISBN-13: 9781011600670
- ISBN-10: 1011600676
- Artikelnr.: 56703710
Herstellerkennzeichnung
Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
gpsr@libri.de
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für