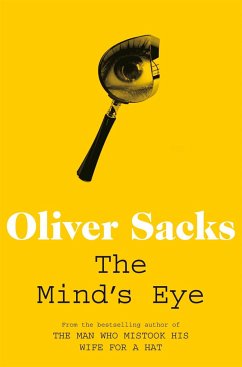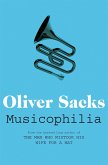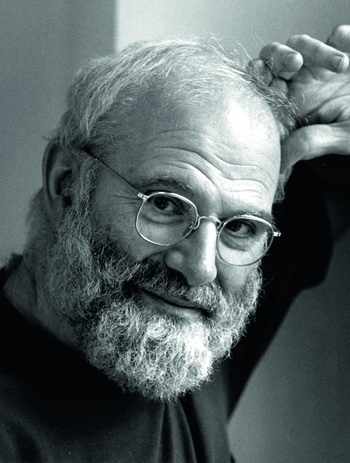Oliver Sacks über optische Täuschungen des Gehirns
Solange das Gehirn funktioniert, wie es soll, präsentiert sich uns die Welt aus einem Guss. Erst wenn etwas schiefläuft, wird klar, dass das Wahrnehmen aus einer Abfolge komplexer Prozesse besteht, die an jeder Stelle unterbrochen werden kann. Menschen, die plötzlich nicht mehr lesen können, sich schriftlich aber ebenso gewandt ausdrücken wie zuvor, oder die mit der Fähigkeit, Farben zu sehen, auch die Fähigkeit verlieren, sich Farben vorzustellen, ermöglichen den Hirnforschern besser zu verstehen, was im Kopf vor sich geht. Für die Betroffenen selbst allerdings sind solche durch Unfälle, Tumoren oder Schlaganfälle hervorgerufenen Störungen eine existentielle Herausforderung: Sie müssen ihre Welt neu ordnen, eine neue Lebensweise finden. Niemand bringt die wissenschaftliche und die menschliche Dimension neuronaler Störungen so feinfühlig zusammen wie Altmeister Oliver Sacks, der sein neues Buch visuellen Wahrnehmungsstörungen widmet.
Diagnose steht bei Sacks weniger im Vordergrund als die Frage, wie die Menschen mit ihr zurechtkommen. Lilian, der Sachs eine extrem seltene "musikalische Alexie" attestiert, kann zunächst keine Noten mehr lesen. In Wahrnehmungstests in der Klinik schneidet sie schlecht ab, dennoch meistert sie ein aktives soziales Leben, unterrichtet weiterhin Meisterkurse an der Musikhochschule, gibt Konzerte. Ihre Strategie, der langsam fortschreitenden Erkrankung Normalität abzutrotzen, nennt Sacks "Hyperaufmerksamkeit": Sie orientiert sich an Geräuschen, Stimmen, Farben, hat die Ordnung im Supermarkt im Kopf. Die sensorischen Areale des Gehirns sind untereinander komplex vernetzt, so Sacks, deshalb sollte man sehr vorsichtig mit der kontextlosen Rede sein, "etwas sei rein visuell oder rein auditiv oder rein sonst etwas".
Patricia hat nach einer Gehirnblutung nicht nur die Fähigkeit zu sprechen, sondern die Sprache selbst, die Ausdrucksfähigkeit, verloren. Aphasie wird in Medizin und Öffentlichkeit als eine Art endgültige Katastrophe wahrgenommen, so Sacks. Doch die Plastizität und die Regenerationsfähigkeit des Gehirns ist oft weit größer, als die Lehrbücher es erlauben. Patricia wird im Krankenhaus zu einer sozialen Instanz, ihr Zimmer zur Plauschecke.
Sacks berichtet von seiner angeborenen Prosopagnosie, der Unfähigkeit, sich Gesichter anderer Menschen vorzustellen oder zu merken - mit all den Peinlichkeiten, die damit einhergehen. Wie viele Menschen mit angeborenen neurologischen Besonderheiten brauchte er einige Zeit, um zu realisieren, dass sein Gehirn anders funktioniert als das seiner Mitmenschen.
Sind Wörter, Symbole oder Bilder nun die primären Werkzeuge des Geistes, oder gibt es Denkweisen, die den Sinnesmodalitäten vorausgehen, eine eigene Sprache des Geistes, eine reine Bedeutung? "Ich vermag nicht zu entscheiden, ob das Unsinn oder tiefe Wahrheit ist", gesteht Sacks. Er möchte den Philosophen, die sich mit dieser Frage befassen, nicht die Freude verderben.
MANUELA LENZEN.
Oliver Sacks: "Das innere Auge". Neue Fallgeschichten.
Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2011. 282 S., br., 19,95 [Euro]
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
The Mind's Eye is about the possibility of recovery and the inexorable decline of the ageing individual. From this collision of incompatible truths, tragedy is made . . . making this Sacks's most powerful book to date. Sunday Telegraph