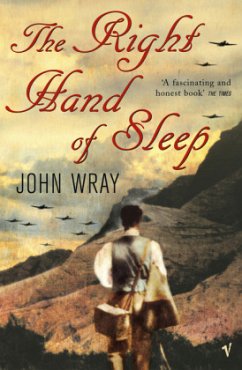Oskar Voxlauer ist auf der Flucht vor seiner Vergangenheit, vor allem vor seinen traumatischen Erinnerungen an die Kämpfe des Ersten Weltkrieges an der italienischen Front 1917. Er hat sich in die österreichische Kleinstadt zurückgezogen, in der er aufgewachsen ist, und lebt dort in den Bergen, entschlossen, eine verborgene, einsame Existenz zu führen. Aber es ist das Jahr 1938, und er kann den wachsenden Spannungen in seinem Heimatland nicht ausweichen. Der Anschluss Österreichs steht dicht bevor, und die Nazis sind schon da - auch in dieser abgelegenen Kleinstadt. Voxlauers Wohltäter, ein jüdischer Gasthausbesitzer, der ihm die Hütte in den Bergen gegeben hat, wird von den neuen Machthabern in den Ruin getrieben. Voxlauer selbst gerät in Gefahr, und das Einzige, was ihn zunächst rettet, ist der Respekt der Gemeinde vor seinen Eltern. Zugleich zieht ihn seine wachsende Liebe zu der geheimnisvollen Else Bauer ins Leben der Stadt zurück. Else Bauer aber ist die Kusine des neuen SS-Führers in der Kleinstadt...

Ein amerikanisches Debüt: John Wrays großer Österreich-Roman
Nur die Christl von der Post fehlt. Sonst sind in John Wrays Roman "Die rechte Hand des Schlafes" alle Versatzstücke einer alpenländischen Nachkriegs-Schnulze da, der ominöse Wind in den Wipfeln, das blitzende Farbenspiel der Fische im gefilterten Licht, ein einsamer Waldhüter (natürlich Amateur), die hohe und leidgeprüfte Frau, die plötzlich aus den Tannen tritt, ein dubioser SS-Offizier und die dumpfen Nazis auf den Bauernhöfen. Ich war mir lange nicht gewiß, ob das (Heimatroman oder Anti-Heimatroman) noch gutgehen kann; und die loyale und kunstvolle Übersetzung von Peter Knecht, die das Ganze so mühelos und poetisch ins Adalbert-Stiftersche zu schieben scheint, hat meine Zweifel eher gesteigert als vermindert.
Das amerikanische Buch wird durch die Übertragung ins Deutsche in eine Traditionssphäre gedrängt, die es im Amerikanischen gar nicht gibt (es sei denn bei James Fenimore Cooper, den einer der Charaktere ironisch zitiert), und die Gefahr ist nicht zu unterschätzen, daß man diesem Roman gerade in seinem deutschen Gewande mißtrauen wird, ohne ihn gründlich gelesen zu haben. Jeder gute Roman ist eine Intelligenzprobe, nicht nur des Autors. Mit Bedacht gesagt: "Die rechte Hand des Schlafes" ist das rühmenswerte Meisterstück eines einunddreißigjährigen Schriftstellers, der mit seinem ersten Buch die Szene der internationalen Literatur bescheiden und zugleich mit Entschiedenheit betritt. Mit einer solchen Souveränität, politisch korrekt oder nicht, hat schon lange niemand zu erzählen gewagt.
Es wäre einfach zu behaupten, daß dieser Roman vom Waldgebirge und dem Anschluß Österreichs an das Großdeutsche Reich über Natur und Geschichte handelt. Das haben viele amerikanische Kritiker gesagt, aber es genügt nicht. John Wray konfrontiert uns mit Charakteren, die selbst nicht immer genau wissen, ob sie das Gute oder das Böse tun, und er zeigt uns, wie die Geschichte ins Gebirge emporsteigt und jedes individuelle Leben, auch gegen seinen störrischen Widerstand, so oder so politisiert.
Der Waldhüter, der ja keiner ist (sondern Sohn eines beliebten Operettenkomponisten und einer Sängerin, die sich in die Provinz zurückgezogen haben), mag sich am Funkeln der Forellen und am schönen Geschwirre der alljährlich wiederkehrenden Schmetterlinge freuen, aber das sind Illusionen. Denn die Fischzucht und der Wald, den er hüten soll, gehören einem Freunde der Familie, dem jüdischen Gastwirt Ryslavy unten in der Kleinstadt, und als der nationalsozialistische Mob, angeführt von dem konkurrierenden arischen Gastwirt, Ryslavys Wirtschaft zerstört und plündert, beginnt der Waldhüter endlich zu begreifen, in welchem Netz er gefangen ist - zusammen mit seiner geliebten Else, die manchmal nach Walderdbeeren, manchmal nach Schnaps riecht und sich seiner angenommen hat, ohne ihm zu gestehen, daß sie nicht nur die Kusine des neuen Gestapochefs im Tale ist, sondern auch dessen frühere Geliebte und Mutter seiner nun siebenjährigen Tochter.
Also noch ein "Bergroman", von einem Nachfolger Hermann Brochs? Mitnichten, denn Wray ist dem Mythischen und der Psychologie der Massen ganz und gar abgeneigt, und ich bin versucht (Germanisten, bitte nicht herhören), sein Kapitel von den Fährnissen eines kleinen und harmlosen Vegetarierkollektivs, das sich in die Berge zurückgezogen hat (eine Post1968er-Kommune, ein wenig vordatiert), als Parodie auf Brochs beängstigende Sekte aufzufassen; und während der gefährliche Marius Ratti seine Leute in einen neuen zerstörerischen Wahn stürzt, erweist sich Herr Piedernig, welcher der Kommune väterlich vorsteht, als sympathischer Scharlatan, der mit seinen Männern, Frauen und Kindern über die Gipfel nach Italien flüchten will (es geht aber nicht gut aus).
John Wray ist, seiner Mutter nach, ebenfalls aus Österreich, aber er ist als Epiker ein instinktiver Wiener Neopositivist, der auf dem Konkreten, Gegenständlichen und Einzelnen besteht (nicht auf panoramatischen Abstraktionen) und sich nicht scheut, Antworten auszusparen und sie der denkenden Leserschaft zu überlassen. Das alles beginnt in der Kärtner Jugend Oskar Voxlauers, der mit kaum siebzehn Jahren an die Isonzofront kommandiert wird und, nach einem feindlichen Volltreffer in seiner Batterie, hinter seiner Truppe zurückbleibt, konfus und ohne Waffe. Von österreichischen Husaren aufgegriffen, die ihn der Fahnenflucht verdächtigen, wird er vor einen Offizier gebracht, der ihm befiehlt, einen Deserteur, der vor ihm im Schnee kniet, zu erschießen, und er folgt dem Befehl, noch immer verwirrt und halb im Bewußtsein, sein eigenes Leben zu retten. Am nächsten Tage desertiert er mit tschechischen Soldaten, schlägt sich durch Ungarn, wo die bolschewistische Revolution ausgebrochen ist, in die Ukraine, wo er in der kleinen Bauernwirtschaft bei der tapferen Anna eine Zuflucht findet und ihr dann, aus freiem Willen und ungeachtet seiner leninistischen Flausen, in ein Zwangsarbeitslager für Kulaken folgt.
Im März 1938 sitzt der Spätheimkehrer im Zug nach Österreich, die Nationalsozialisten sind eben im Begriffe, die Macht zu ergreifen, und seine Mutter wartet im alten Haus. Er will aber nicht mehr unter Leute, erprobt sich als ungelenker Waldhüter und wird von der geheimnisvollen Else gepflegt und geliebt, als er sich eine Schrotladung in die Beine jagt. Sie sagt ihm lange nichts über den Gestapokommandanten, für sie nur "Kurti", der seine eigene Vergangenheit hat, über die er nicht spricht. In einem hervorragenden Kapitel des Romans erzählt Kurti selbst, wie er unter den Nazi-Putschisten war, die im Sommer 1934 das Wiener Kanzleramt erstürmten und Dollfuß töteten und wie es ihm gelang, durch eine Dachluke ins Freie zu fliehen, als der Putsch zusammenbrach. Er wird in Berlin, im Stabe Himmlers, der Fahnenflucht bezichtigt und darf sich und seine Karriere retten, indem er den unglückseligen Organisator des mißlungenen Putsches, welcher der Partei lästig geworden ist, auf Befehl der oberen Parteistellen erschießt. Der belohnte "Illegale" hält seine Hand über Else, die gemeinsame Tochter Resi, und den ehemals fahnenflüchtigen Voxlauer oben im Walde - aber wie lange?
Eine ganze Generation deutscher und österreichischer Schriftsteller und Schriftstellerinnen suchte in den Jahrzehnten nach 1968 und mit wechselndem Glück, ihren politischen Roman zu schreiben. Jetzt kommt ein Dreißigjähriger aus Brooklyn, der aussieht wie ein begabter College-Student, und zeigt, wie man das machen kann, ruhig und mit einer epischen Selbstgewißheit, die man entweder hat oder nicht. Eine komplizierte Geschichte, aber nichts Ausgetüfteltes. Seine erste Tugend ist die des diskreten Erzählers, der seine lädierten Menschen akzeptiert, wie sie sind, gedrängt von ihrer Vergangenheit oder historischen Vorgängen: ob Else, die lügt, um Voxlauer nicht zu verlieren, ob Voxlauer, eher impulsiv und wortlos, wenn er einem Dorfnazi den Bierkrug gegen den Schädel haut oder seinen jüdischen Freund bittet (in Anwesenheit der Schutzstaffelleute), eine Rede am Grabe seiner Mutter zu halten.
Dieser Erzähler ist kein Besserwisser, der sich kritisch über seine Figuren erhebt, und seine Methode, aus wechselnden Blickpunkten zu sprechen - einmal als Epiker (die Gestalten in Distanz als Er und Sie) oder aus der Ich-Perspektive Voxlauers und Kurtis -, funktioniert ohne viel Aufhebens und ohne daß gar die Aufmerksamkeit auf das Kunstmittel selbst gelenkt würde. Im Anfang wählt er noch, mit Voxlauer, ein entsprechend schleppendes Zeitmaß, aber sobald sein Wider- und Gegenspieler Kurti auftaucht, steigert er das Tempo der Montage, vor allem gegen Ende, zu einer quälenden Dramatik, Schnitt für Schnitt, in einem Film, in dem es unmöglich wird, noch Atem zu holen.
Man widersteht aber der Spannung, weil man den Text nicht aus den Augen verlieren will; wie die Menschen miteinander reden, Else mit Voxlauer, aber auch Ryslavy mit den beiden, hat eine merkwürdige, spielerische oder gar selbstironische Formalität oder eine fast spröde Grandezza, die fast an das amerikanische "kidding" erinnert, den trockenen Konversationston Ebenbürtiger, die Vertrauen zu einander fassen, eine Möglichkeit der Intensität ohne Pathos oder Kitsch. Über diesen John Wray wird man noch viel reden müssen, pro und kontra, und das ist gut so.
John Wray: "Die rechte Hand des Schlafes". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Peter Knecht. Berlin Verlag, Berlin 2002. 382 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main