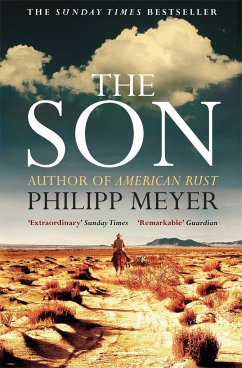NOW A MAJOR TV SERIES: the critically acclaimed, New York Times-bestselling epic, a saga of land, blood and power, follows the rise of one unforgettable Texas family from the Comanche raids of the 1800s to the oil booms of the 20th century
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Ein ehemaliger Finanzhai ist gerade dabei, zu einem der großen Chronisten Amerikas zu werden: Philipp Meyers Roman "Der erste Sohn" ist ein Breitwand-Epos und so spannend wie ein Abenteuerbuch.
Landschaften werden unterschätzt. Sie gelten als kulturloser Leerraum zwischen Städten oder dienen als Hintergrund für harmlose Gemälde. Doch Landschaften, bis auf ein paar Kratzer an der Oberfläche seit Äonen unverändert, sind die eigentlichen Machthaber auf unserem Planeten. Mit stoischer Beharrlichkeit formen sie Lebewesen und Lebensweisen. Und geben sie nicht sogar vor, wie sie besungen werden wollen? So wie der verspielte Zickzackkurs des Rheins den lyrischen Ton und schwülstige Nixenromantik fordert, so lassen die weiten amerikanischen Prärien und gigantischen Plateaus, will man ihnen gerecht werden, nur die Form des schwartendicken Epos zu.
An "Once Upon a Time in the West"-Sagas herrscht fürwahr kein Mangel, aber das, was Philipp Meyer nun mit dem fünf Generationen übergreifenden Familienroman "Der erste Sohn" vorgelegt hat, ist ein Novum, weil es dem letzten Aufbäumen des "Wilden Westens" in Texas ohne falsche Verklärung einer der einander jahrzehntelang befehdenden Parteien - Indianer, Texaner und Mexikaner - in geradezu fotorealistischer Drastik ein Denkmal setzt, vor dem man schon allein aufgrund des verarbeiteten Recherchematerials nur den Hut ziehen kann. Zudem kann Meyer Figuren entwerfen, die sich dem Leser nicht anbiedern. Und doch wirkt nichts an diesem wissensprallen Roman, in dem man insbesondere über indianische Gebräuche sehr viel lernen kann, langweilig oder belehrend, im Gegenteil. Meyer setzt in einem Ausmaß auf Spannung und Blutvergießen, dass man die sechshundert Seiten mit fast schon schlechtem Gewissen einfach wegschmökert wie den dicksten Karl-May-Band.
In diesem Versuch, das amerikanische Wesen aus seiner Genealogie zu erklären, einer "Great American Novel" also, ist Moral keine allzu wichtige Kategorie, sieht man davon ab, dass Meyer einer letztlich entwürdigenden Indianer-Idealisierung entgegentritt. Die hier in all ihrer Binnendifferenzierung dargestellten Indigenen nämlich vergewaltigen und töten ebenso gnadenlos, wie es die Cowboys tun, wenn auch - vielleicht doch ein kleiner Restbestand an Heroisierung - nicht aus Mordgier oder Rache. Am nächsten an eine Grunderkenntnis kommt denn auch die mehrfach wiederkehrende und durch ein Edward-Gibbon-Motto (es hätte auch Oswald Spengler sein dürfen) gestützte Aussage heran, dass die Geschichte eine endlose Abfolge von einander auslöschenden Imperien darstelle: Die zahlreichen Indianerstämme in Amerika haben schließlich zunächst die Mogollon-Kultur vernichtet. "Sie alle wurden von den Apachen ausgelöscht. Die wiederum, jedenfalls in Texas, von den Comanchen ausgelöscht wurden. Die schließlich von den Amerikanern ausgelöscht wurden." Wenn es dabei überhaupt eine Schuld gibt, verteilt sie sich gleichmäßig auf alle Ethnien und Imperien. Allerdings widerspricht die Erzählung dieser alles Individuelle einebnenden Dekadenzthese im Detail dann doch.
Außerdem ist nicht die Überwindung einer denselben Lebensraum besiedelnden Kultur hier das eigentliche Thema, die alte Western-Thematik, sondern vielmehr die Vermischung der Kulturen, und zwar gleich auf mehreren Ebenen. Der Hauptprotagonist und Stammvater der McCullough-Dynastie, Eli McCullough, geboren 1836 kurz nach der Unabhängigkeit der Republik Texas von Mexiko, daher "der erste Sohn", wird mit dreizehn Jahren von Comanchen entführt, die seine Mutter und seine Schwester fürchterlich misshandeln und töten ("Sie hatten ihr die Brüste abgeschnitten und die Eingeweide herausgerissen"). Eli, ein Draufgänger schon als Jugendlicher, der sich für das Gejammer des schöngeistigen Bruders schämt und es folgerichtig zu finden scheint, dass die Comanchen auch diesen schließlich mit ihren Lanzen durchbohren ("Ich wusste, ich sollte aufstehen und meinem Bruder helfen, ... doch ich wollte nicht"), wächst drei Jahre bei den Indianern auf und wird einer von ihnen, indem er sich durch Mut und Härte den Respekt seiner neuen Familie verdient: Er reitet mit auf Beutezüge und skalpiert seine Opfer.
Als ein unbezwingbarer Gegner - die Pocken - seine Gruppe arg dezimiert hat, kehrt Eli zu den Weißen zurück, ohne dort wirklich Anschluss zu finden. Ein kitschiger Roman hätte hier den edlen Wilden im Weißen hervorgekehrt: Meyer tut das Gegenteil, er zeigt einen Entwurzelten, der an der Gesellschaft scheitert. Die einzige Tätigkeit, bei der Eli die vertraut gewordene Lebensweise fortsetzen kann, ist das (durch ein Fehlverhalten erzwungene) Anheuern bei den Texas Rangers. Nun tötet er eben beherzt Indianer. Einige Zeit später aber bemerkt Eli, dass eigentlich eine ganz andere Gruppe von Westlern ähnliche Freiheiten genießt, wie er sie bei den Comanchen kennenlernte: die Reichen. Und mit der Energie, Rücksichtslosigkeit und Opferbereitschaft eines geborenen Patriarchen, inzwischen Colonel genannt, gründet er eine der großen, sklavenbewirtschafteten Texas-Ranches, die zunächst mit der Rinderzucht und später mit Erdölförderung ein Vermögen erwirtschaften. Seine Zeit bei den Comanchen scheint Eli unverwundbar gemacht zu haben, aber doch fragt man sich, ob er nur eine der beiden Hauptlektionen von seinem Ziehvater Toshaway gelernt hat. Dieser hatte ihm erklärt, es sei natürlich, anderen wegzunehmen, was man haben wolle. Einzig die Weißen aber glaubten, das Gestohlene gehöre ihnen; einzig sie seien erstaunt, wenn sie ihrerseits dafür getötet würden. Die zweite, von Eli kaum angenommene Lektion lautete, dass man einen Feigling daran erkenne, dass er nur sich selbst liebe.
Erzählt wird die Familiengeschichte auf mehreren Zeitebenen zugleich, was narrativ eher schlicht, spannungstechnisch aber sehr effektiv ist. Abwechselnd kommen Eli, sein ganz anders gearteter Sohn Peter sowie die wiederum höchst ehrgeizige, ein Erdölimperium befehligende Urenkelin Jeanne Anne, die sich am Sexismus ihres eigenen Umfelds aufreibt, zu Wort. Dank des klugen Arrangements erklären sich viele der angeschnittenen Themen und Familiengeheimnisse erst nach und nach.
Peter ist in jedem Sinne die Antithese zu seinem Vater, ähnelt eher dessen hingerichtetem Bruder. So leidet er offenbar als Einziger am Rassismus im Frontier-Gebiet, der zu immer größeren, diesmal vor allem die Mexikaner treffenden Eruptionen führt. Weil er aber nicht aufzubegehren wagt, protokolliert er im Tagebuch, was geschieht - und wie er doch stets mit den Starken kollaboriert. Das ist ein hinterhältiger Sprengsatz im Roman: die einzig anständig, ja modern wirkende Figur ist ein Schwächling, ein kastrierter Umfaller. Ein Sündenfall steht im Zentrum von Peters Tagebucheinträgen, ein Massaker der McCulloughs und ihrer Verbündeten an den befreundeten Nachbarn, den Garcias, deren Besitz sich die Mörder unter allgemeinem Beifall angeeignet haben. Doch eine Überlebende gibt es, und ausgerechnet diese sucht Peter eines Tages auf. Es droht eine Vermischung ganz eigener Art.
Philipp Meyer wird man Ängstlichkeit kaum vorwerfen können, er schreibt in voller Rüstung. In seinem ersten Leben war Meyer Wall-Street-Händler, der mit Derivaten hantierte und plötzlich im Geld schwamm. Seine im Jahre 2010 in der Zeitschrift "Literaturen" erschienene, heute im Netz einsehbare Abrechnung mit einer dekadenten Finanzwelt - höchste Achtung genießt dort Meyer zufolge das Erbrechen Tausende Dollar teurer Menüs auf Unbeteiligte - ist eine faszinierende Lektüre. Mit "Rost", seinem fulminanten Romandebüt über den amerikanischen "Rust Belt", die verfallende Industrieregion im Nordosten der Vereinigten Staaten, wurde Meyer auf Anhieb zu einem der wichtigsten Chronisten Amerikas, der in einem Atemzug mit Faulkner und - neuerdings - Cormac McCarthy genannt wird.
"Der erste Sohn" nun zeigt uns, wie eine Denkweise, die republikanische, aus einer Zeit und einer Landschaft heraus entsteht, ohne diese Zeit zu beschönigen oder einmal mehr im Namen des metrosexuellen, intellektuellen New York (die auch in Europa beliebteste Brille für den Blick nach Übersee) über den bis heute lebendigen, bewaffneten Pioniergeist Gericht zu halten. Man mag es nach der Lektüre fast glauben: Die Dynastien, Stämme und Imperien werden weiter kommen und gehen, und das stets mit Gewalt; aller Glaube an den ordnenden, bändigenden Eingriff ist Selbstbetrug. Halten wir uns lieber an das, was bleibt: die Landschaft.
OLIVER JUNGEN
Philipp Meyer: "Der erste Sohn". Roman. Aus dem Amerikanischen von Hans M. Herzog. Knaus Verlag, München 2014. 608 S., geb., 24,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
'Stunning ... a book that for once really does deserve to be called a masterpiece' Kate Atkinson