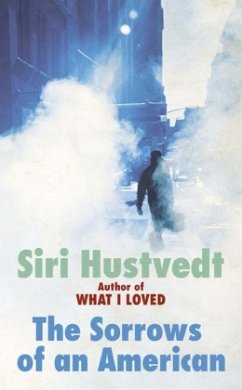Arroganz wirkt niemals herausfordernder, als da wo sie in sich gehen möchte: In Siri Hustvedts Roman „Die Leiden eines Amerikaners” reden die Figuren über den Irak-Krieg, den 11. September, über Kant und das Ding an sich und schmecken dabei nach nichts Von Burkhard Müller
Amerika gebraucht gern Formeln, in denen es sich selbst exemplarisch auf den Punkt bringt, American Beauty, American Pie, The American Dream, notfalls selbst The Ugly American. Aber der Titel „Die Leiden eines Amerikaners”, im Original „Sorrows of an American” geht über die bloße Selbstbespiegelung hinaus. Siri Hustvedt stellt ihn auf wie ein Vorfahrtszeichen: Besondere Leiden sind es, sie haben Vorrang gegenüber allem, was auf der Welt sonst noch so gelitten wird.
Eins dieser Leiden ist zum Beispiel der Irak-Krieg. „Im amerikanischen Bürgerkrieg nannte man das Soldier‘s Heart”, sinniert der Ich-Erzähler, der Psychoanalytiker Erik Davidsen, „später bekam es den Namen Shell Shock und dann Kriegsneurose. Jetzt heißt es PTBS, Posttraumatische Belastungsstörung – eine denkbar antiseptische Bezeichnung für das, was einem Menschen passieren kann, wenn er etwas erlebt, wofür es keine Worte gibt.” Einem Menschen heißt einem Amerikaner. Traumatisierte Irakis sind diesem melancholischen Grübler nicht einmal einen Nebensatz wert.
Sonia, Eriks achtzehnjährige Nichte, wird als Überlebende des 11. September dargestellt – wobei „Überlebende” einfach bedeutet, dass sie, wie alle New Yorker, die einstürzenden Türme gesehen hat. „Und sie will noch immer keine Therapie machen?” fragt der besorgte Onkel. Nein, die Nichte verkapselt sich in ihrem Gram. „Sonia wollte keine Welt, in der Gebäude einstürzten und grundlos Kriege geführt wurden.” Man beachte das Wort „grundlos”. Ein begründeter Krieg würde die Schwermut aus diesem Mädchenherzen sofort verbannen.
Arroganz wirkt niemals herausfordernder, als da wo sie in sich gehen möchte. Denn dann wird es offenbar, wie wenig sie über ihren Schatten springen kann. Es gibt die Geschichte von dem Pensionstöchterlein, dass einen Aufsatz zum Thema „Eine arme Familie” schreiben soll. Sie schreibt: „Alle waren arm. Der Vater war arm. Die Mutter war arm. Die Tochter war arm. Das Kindermädchen war arm. Der Butler war arm. Der Gärtner war arm. Der Chauffeur war arm . . . ”. So ähnlich ist das mit den „Leiden eines Amerikaners” auch. Man soll dieses ziemlich schlecht komponierte Stück Prosa allein schon deswegen in allen seinen Facetten interessant finden, weil seine Figuren als solche Aufmerksamkeit verdienen. Denn schließlich handelt es sich nicht um irgendwen.
Außer besagtem Analytiker ist da seine Schwester Inga, Medienwissenschaftlerin oder etwas Ähnliches, die sich die mediale Zurichtung des 11. September zum Thema gemacht hat. Noch bedeutsamer jedoch ist sie als Witwe des Schriftstellers Max Blaustein, eines Titanen, zu dessen Figur Hemingway und Philip Roth bescheidene Beiträge leisten durften. Ihre gemeinsame Tochter Sonia dichtet auch schon, und zwar in Stanzen.
Diese vier also, drei Anwesende, ein Toter, bilden die königliche Familie, um die die Vasallen kreisen, welche leider so manchen Verdruss stiften: Edie, Max‘ frühere Geliebte, die auf einem Haufen alter Briefe sitzt und diese – man denke! – zu Geld machen will, weil sie knapp bei Kasse ist; Harry, Ingas jetziger Lover, der eine Biografie über den verstorbenen Ehemann schreiben möchte; Miranda, Eriks neue Mieterin, eine Comic-Künstlerin aus Jamaica, die ihrem Vermieter nicht so nah kommt, wie dieser es sich wünscht, wenngleich er mit ihrer kleinen Tochter Eggy Freundschaft schließt; schließlich eine abscheuliche Klatsch-Journalistin namens Fehlburger, die hinter Blausteins verjährten Skandalgeschichten her ist. Sie nährt, wie sich herausstellt, einen alten Groll gegen Inga, die schon an der Uni über sie hinweggesehen und sie ausgelacht hat; man braucht es kaum erwähnen, dass Inga sich nicht an sie erinnert.
Einen kleinen Kontrastakzent in dieses Königsdrama soll sie setzen, erweist sich aber in ihrer Niedertracht, sicher gegen den Willen der Autorin, als das lebendigste und sympathischste Kraut am Fuße all dieser Rilke und Celan zitierenden Hochgewächse. Blass ist gar kein Ausdruck für diese Figuren. Wenn sie miteinander reden, klingt es so: „Ich will mich gar nicht entschuldigen. Allmählich sah ich ja selbst, wie verrückt ich war, wie schwierig, eitel und verblendet. Ironischerweise hatte ich über das Sehen geschrieben, über unsere Wahrnehmung der Welt. Wir können – wie Kant sagt – nicht auf das Ding an sich kommen, niemals, was aber nicht heißt, dass es keine Welt gäbe. (. . . ) Zwischen meiner Selbstwahrnehmung als ausgeprochen ernstzunehmendem, ausgesprochen wichtigem Menschen und meinem Bild dessen, wie andere mich wahrnahmen, klaffte ein himmelweiter Unterschied.” Das ist Inga in einem aufgewühlten Augenblick. Ein Teil dieser quälenden Steifheit mag aufs Konto der Übersetzer Uli Aumüller und Gertraude Krueger gehen, als Grundhaltung aber gehört sie bestimmt der Autorin selbst.
Die Figuren sind immerfort am Analysieren, jedoch ohne intellektuellen Ehrgeiz. Was sie sagen, ist abstrakt, aber simpel und frei von Überraschungen, nichts ist darunter, was man einen Gedanken nennen könnte. Wenn ein Psychoanalytiker und eine Psychoanalytikerin miteinander ins Bett gehen und sich gegenseitig bescheinigen, „Übergangsobjekt” zu sein, so steckt in dieser Szene eine verdrehte Komik, die sich z.B. Woody Allen bestimmt nicht hätte entgehen lassen. Hustvedt verzieht keine Miene.
Erik träumt von Miranda, nachdem er mit ihr essen war: „Sie küsste mich höflich auf beide Wangen, bedankte sich für den ‚wunderbaren Abend‘ und überließ mich dann meinen imaginären Heldentaten, bei denen sie, wie gewöhnlich, keine geringe Rolle spielte." Wenn das Humor sein soll, kann man ihn nur als grässlich bezeichnen. Oder es soll sich ein erinnerter Augenblick mit besonderer atmosphärischer Dichte aufladen, Sonnenflecken werden genannt, ein Bach hinter dem Haus, ein Schwarm Stare; die Autorin ist zurecht der Ansicht, dass in diesem Ensemble noch der Zauber fehlt, der alles bände, also reicht sie ihn nach: „Meine Schwester hielt die Augen geschlossen. ‚Es war wie ein Wunder, nicht? Als ob die Geschichte wahr geworden und die Welt tatsächlich verzaubert wäre.‘ Ich nahm Ingas Hand, drückte sie und sagte nach kurzem Schweigen: ‚Das war sie auch.‘” Wenn gleich zwei Zeugen bestätigen, wie zauberhaft alles war, dann muss es doch wohl stimmen! Der Leser, zu einem scheinbar opulenten Mahl geladen, versucht immerzu, so etwas wie die schmeckbare Eigenart dieses Buchs auf die Zunge kriegen – und er schmeckt nichts, einfach nichts; noch nicht einmal die leise Bitterkeit der Wortgewandten, die von sich selbst nichts zu sagen wissen.
Hustvedt muss es doch gemerkt haben, wie leblos ihre Story trotz aller schnitzeljagdhaften Heimlichtuerei geblieben ist. Darum macht sie Nebenschauplätze auf: Außer der Parallelhandlung von Miranda und ihrer quirligen Tochter mit süßem Kindermund vor allem das Erinnerungsbuch von Eriks und Ingas Vater, das nach dessen Tod auftaucht, und die Ausflüge ins ländliche Minnesota, die sich daraus ergeben. So soll die fehlende Tiefe von Raum, Zeit und Klasse eingebracht werden.
Hier hat sich Hustvedt, wie sie im Nachwort sagt, sehr stark von einem ähnlichen Dokument ihres eigenen Vaters inspirieren lassen, in dem das herbe Dasein norwegischer Einwanderer im Mittleren Westen geschildert wird. Im Ton der Befriedigung berichtet sie davon, dass gerade das unwahrscheinlichste Detail, der Tod ihres Onkels David, genannt der Bleistiftmann, das schlackenfrei authentischste sei. Aber Authentizität ist ein fragwürdiges Stärkungsmittel für Romane. Die authentischen Fakten, die frech darauf beharren, geschehen zu sein und damit basta, sprengen den ohnehin schwachen Rahmen dieses Buchs.
Mit einem gewissen Trotz zählen die letzten Seiten des Buchs noch einmal alle disparaten Vorgänge auf, als könnte so aus dem insistent gesetzten Neben- und Nacheinander ein Ganzes hervorgezwungen werden. Ja, das Leben! Wo es da ist, glaubt man ihm aufs Wort. Inga, deren Gestalt mit ihrer Autorin eine wohl mehr als oberflächliche Ähnlichkeit hat, trinkt jedoch mit Vorliebe koffeinfreien Espresso. Davon hat ihr Siri Hustvedt reichlich eingeschenkt.
Siri Hustvedt
Die Leiden eines Amerikaners
Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Uli Aumüller und Gertraude
Krueger. Rowohlt Verlag, Reinbek 2008, 416 Seiten, 19,90 Euro.
Ein begründeter Krieg würde die Schwermut sofort verbannen
„Ironischerweise hatte ich über das Sehen geschrieben, über unsere Wahrnehmung der Welt. Wir können – wie Kant sagt – nicht auf das Ding an sich kommen, niemals, was aber nicht heißt, dass es keine Welt gäbe.” Die „American Peace Flag” in New York bei einem Protest gegen den Irak-Krieg. Foto: Paul Fusco / Magnum
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Ob der Ehemann Paul Auster ihr dabei wohl über die Schulter geschaut hat? Siri Hustvedt lässt einen Analytiker eine Geschichte von Vatermord und anderen Geheimnissen erzählen.
Siri Hustvedt ist eine Meisterin magischer Anfänge. In ihrem ersten Roman "Die unsichtbare Frau" (1993) soll Iris, eine Literaturstudentin, Gegenstände einer Toten beschreiben: einen Handschuh, ein mit Make-up verschmiertes Wattebällchen und einen Spiegel. Flüsternd, um ihre Stimme anonym klingen zu lassen, spricht sie im Auftrag eines sie dafür entlohnenden Mannes ihre Beobachtungen penibel auf ein Band. Doch Mr. Morning ist nicht zufrieden. Iris vergaß zu erwähnen, wie der Handschuh riecht. Was den Mann zu seiner Sammelleidenschaft treibt, bleibt ungeklärt. Als Schatten aber geistert er Iris noch lange nach dem letzten Treffen in seiner düsteren New Yorker Wohnung durch den Kopf. Nichts verschwindet wirklich. Spricht man aber darüber, wird alles nur verworrener. Hustvedt balancierte zwischen Rätseln, die man lösen kann, und Geheimnissen, die es zu bewahren gilt. Das englische Wörtchen "yonder" hat sie einst in einem Essay besungen - "zwischen hier und dort" heißt es ungefähr übersetzt.
Nun aber, nach zwei weiteren Romanen, zuletzt dem zum Bestseller avancierten "Was ich liebte", zerrt diese Bewohnerin der Zwischenräume Geheimnisse mit einer Wucht ans Licht, als gelte es, dem großen Trauma Amerikas, dem Amerika nach 9/11 und dem nach zwei Kriegen, eine Stimme zu geben, die alles erklärt. Der Titel "Die Leiden eines Amerikaners" macht das Private zum allgemeinen Belang. Das Private sind Briefe des Vaters der Autorin. Lloyd Hustvedt, der 2003 starb, schildert darin Kriegserlebnisse. Teile seiner Erinnerungen sind wörtlich in den Roman eingegangen. Für den allgemeinen Aspekt setzt Siri Hustvedt das Land und seine Menschen diesmal dem gnadenlos in traumatischen Wunden wühlenden Blick der Psychologie aus.
Ich-Erzähler Erik ist Analytiker. Spuckt ihn eine Klientin an, wischt er sich reglos mit einem Kleenex den Speichel vom Gesicht und sagt still zu sich: "Sie war doch von Anfang an ein vergessenes Kind." Nach schwierigen Telefongesprächen hat er Schuldgefühle. Davon erleichtern sich profunde Seelenspezialisten wie Erik, mit dem Phänomen der Übertragung bestens vertraut, durch die Frage: "Fühle ich meine Schuld oder die eines anderen?". Wechselt seine Schwester Inga das Thema, schiebt er ein: "Ich nenne das eine eloquente Abwehr." Kurz: Erik übertrifft noch den typischsten Analytiker und ist einer, der für alles Namen und Begriffe hat.
Dass diese Dauer-Souveränität bisweilen auf die Nerven geht, könnte man als kalkulierten Effekt honorieren - genial, wenn sich der Leser auch dagegen sperrt. Schließlich geht es in diesem Buch vor allem um Abwehr und darum, wie man sie am besten brechen kann. Romane wie die von Irvin D. Yalom ("Die Schopenhauer-Kur") wuchern mit diesem Pfund der Erkenntnis. Eriks kontrollierender Blick auf Geheimnisse hat aber noch einen anderen Effekt: Er verspricht ein Nicht-Nachlassen von Aufmerksamkeit, eine ständige Verunsicherung, ein Nicht-Zufriedengeben mit naheliegenden Lösungen.
Mehr denn je braucht Siri Hustvedt jetzt die ordnende und wieder zerstörende Kraft eines bohrenden, psychologischen Blicks, um ihre Fäden zusammenzuhalten. Mit Themen geizt sie dabei nicht. Als wäre Amerika in den Menschen und deren schmerzhaften Eindrücken komprimiert, stapelt sie Geschichten und Bilder übereinander, vom Krieg, vom 11. September, vom Irak, von schwarzer und weißer Identität. Erik ist ein Umschlagsplatz von Zeitgeschichte, die ihn nach der Entdeckung der eigenen väterlichen Aufzeichnungen bis in Träume hinein umzutreiben und kaum sichtbar zu verändern beginnt: Er entdeckt den Brief einer Kindheitsfreundin, die den Vater an einen alten Schweigeschwur gemahnt. Galt es, ein Verbrechen zu decken? Das Rätsel bildet die Hauptspur des Romans, doch ist nicht dessen Auflösung das Spannende; es sind die Nebengeschichten, die das Rätselraten entfesselt. Erik, der all das so scheinbar sicher erzählt, gerät dabei unmerklich ins Schleudern. Und gerade das ausdauernde Festhalten an seiner Souveränität, seine fast redundante, keinesfalls radikale Wesensänderung befördert beim Lesen schließlich aber keine Aggression, sondern einen unglaublichen Sog.
Zeitgleich brechen die Menschen um Erik an inneren Konflikten und der Impertinenz anderer zusammen. Seine Schwester Inga, Frau des vor kurzem verstorbenen berühmten Autors Max, wird von einer Journalistin erpresst. Diese will die Öffentlichkeit mit einer unrühmlichen Affäre von Max unterhalten, aus der auch ein Kind hervorgegangen sein soll. Miranda, Eriks unnahbare, von ihm heimlich verehrte Untermieterin, die nachts bestialische Frauen zeichnet (Hustvedt liebt solche Hell-dunkel-Figuren), wird regelmäßig vom Vater ihrer fünfjährigen Tochter Eggy heimgesucht. Dieser unberechenbare Lane wiederum, der sich Künstler nennt, scheut nicht davor zurück, in Wohnungen einzubrechen, um fassungslose Menschen für seine Ausstellung zum Thema "multiple Persönlichkeit" zu fotografieren. Auch Erik erwischt er auf diese Weise im seltenen Augenblick eines Kontrollverlusts - sein wutentstelltes Gesicht (er hatte Lane gegen den Spiegel geschubst) hängt Wochen später in einer öffentlichen Galerie. "Väter" tituliert Lane diese Foto-serie. Um Väter dreht sich überhaupt der ganze Roman, als ginge es im Leben vor allem darum, Autoritäten zu minimieren oder wenigstens zu verarbeiten.
Wie Siri Hustvedt dieses lebenslängliche Aufbegehren unaufdringlich in einem komplexen, federleicht erzählten Roman aufgehen lässt, ist eine Kunst, die ihr nur deshalb so gut gelingt, weil sie auf erprobte Techniken vertraut: unheimliche Fährten, die bis ins Körperliche hinein spürbar sind, etwa wenn Erik die ersten Fotografien von Miranda und ihrer Tochter auf der Treppe entdeckt - mit ausgestochenen Augen; morbide Gelüste wie die jener zwei alten Frauen, die, statt viel zu sprechen, verstörende Puppen bauen, von Gram gezeichnete, betörend realistische Menschlein, deren Glieder und Haut versehrt sind; oder die Beschreibung von Ingas Absencen, die sie schon als Kind engelhaft erscheinen ließen. Solche Passagen sind wie Zugänge zu jener dunklen Spur, welche die Romane von Siri Hustvedt so eigen, so anziehend machen. Andere Szenen wirken hingegen platt, weil die Autorin zu deutlich ausstellt, dass sie ihren Freud oder Winnicott gut kennt.
Man ahnt, dass diese Prosa nicht zuletzt Lebensabwerfungen der Autorin sind, auch ein Reflex auf ihre eigene, in Norwegen wurzelnde Familiengeschichte. Ehefrau eines Autors (Paul Auster) ist sie ja selbst - wie ihre Figur Inga, die der Rolle nicht nur Positives abgewinnt. Die berührenden Berichte des Vaters einzubauen, die im Roman Eriks Vater Lars Davidsen zugeschoben sind, zeugt von Mut und erwirkt eine Intimität, die erst durch den fiktionalen Überbau Gestalt erhält. Schonungslos konfrontiert sie nun das große Personal ihres Romans mit den alten Dämonen der Vergangenheit. Eriks Vater etwa rammte im Schlaf die Faust durch die Zimmerdecke. Wie ein drohendes Leitmotiv kehrt dieses Bild ständig wieder, als wäre das einkreisende Erzählen selbst schon die zu leistende Arbeit am Trauma. Ganz zu Anfang heißt es einmal von Lars Davidsen, dieser habe alles, sogar Werkzeuge katalogisiert und sich mit einem Ablagesystem Arno Schmidtschen Ausmaßes umgeben, darunter Listen "von Dingen, die es nicht mehr gab" (das Wort "zwanghaft" fehlt hier glücklicherweise).
"Die Leiden eines Amerikaners" ist ein wenig wie dieser Zettelkasten, gut beschriftet, mit viel drin, manchmal penibel überkommentiert, aber auch mit wohltuenden Lücken durchsetzt. Er umspielt jene etwas pathetische "Aura des Verlusts", die Erik einmal spätnachts angesichts einer riesigen Pepsi-Cola-Werbung vor der New Yorker Skyline entdeckt. Man liest eben eine Prosa, die ihre Energie den Toten verdankt - als müssten erst die Väter sterben, damit die Kinder ihr Lebenstempo drosseln und endlich zu denken anfangen. "Mein Leben hatte sich plötzlich verlangsamt", sagt Erik, nachdem der Vater beerdigt ist. Siri Hustvedt dehnt die Zeit danach zum Dauergespräch aus, das insgesamt fesselt.
ANJA HIRSCH
Siri Hustvedt: "Die Leiden eines Amerikaners". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Uli Aumüller und Gertraude Krueger. Rowohlt Verlag, Reinbek 2008. 410 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main