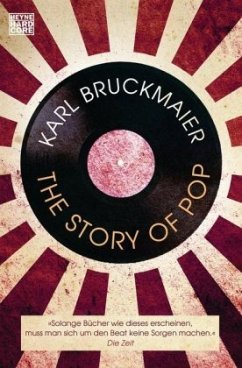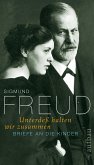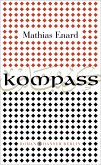»Es gibt keine Erinnerung ohne Musik.« Tennessee Williams
Córdoba im Jahre 822: An diesem Punkt vor über 1000 Jahren beginnt Karl Bruckmaier seine Zeitreise durch die Musikgeschichte. Folgen Sie ihm per Anhalter durch eine Galaxis aus Klang und Farben - mit vielen unerwarteten Zwischenstationen. Ungewöhnliche Helden, magische Orte und wegweisende Ereignisse der Zeitgeschichte weben eine Erzählung der Story of Pop, wie es noch keine gibt. Zwischen Clash der Kulturen und Streben nach Glück: »My life was saved by Rock 'n' Roll!«
Córdoba im Jahre 822: An diesem Punkt vor über 1000 Jahren beginnt Karl Bruckmaier seine Zeitreise durch die Musikgeschichte. Folgen Sie ihm per Anhalter durch eine Galaxis aus Klang und Farben - mit vielen unerwarteten Zwischenstationen. Ungewöhnliche Helden, magische Orte und wegweisende Ereignisse der Zeitgeschichte weben eine Erzählung der Story of Pop, wie es noch keine gibt. Zwischen Clash der Kulturen und Streben nach Glück: »My life was saved by Rock 'n' Roll!«
»Karl Bruckmaier erzählt die Geschichte des Pop schlau und unterhaltsam als Story vom Streben nach Freiheit und Glück.« Rolling Stone

Sie waren immer dabei: Diedrich Diederichsen und Karl Bruckmaier, die einflussreichsten Pop-Kritiker des Landes, erklären, worum es bei dieser Musik geht.
Von Dietmar Dath
Mach das leiser, schalt das aus: Man kennt den Appell aus Jugendzimmern, aus Autos, vom Strand und aus der Bahn, seit es stationäre und mobile Empfänger und Abspielgeräte für Klang gibt. Die gröbstmögliche Begründung dieser Forderung ist die Kränkung des feindlichen Geschmacks: "Das ist doch gar keine Musik!" Diedrich Diederichsen, der die deutschsprachige Plattenkritik und ihre Textnachbarschaft bis zu Betrachtungen aus der Welt der Bildenden Kunst seit mehr als dreißig Jahren umgräbt, gibt dieser Kränkung jetzt recht - auf rund fünfhundert Seiten. Dabei entdeckt er ihr Positives und wendet sie ins Wissenschaftliche: "Pop-Musik ist nicht nur sehr viel mehr als Musik. Pop-Musik ist eine andere Sorte Gegenstand."
Diederichsens Buch "Über Pop-Musik" lehrt so vor allem Kategorienfehlermeldungen nach dem Muster: Wer John Lennon oder Bob Dylan vorhält, sie könnten nach Maßgabe schulmäßiger Intonation, Phrasierung oder Atemtechnik "nicht singen", hat so schlecht zugehört, wie Leute beim Lesen versagt haben, die dem Josephsroman von Thomas Mann vorwerfen, er eigne sich nicht für die Bibelstunde. Die kleinste Einheit der Pop-Musik ist nach Diederichsen eine Figur oder ein Figurenensemble als Konkretion einer Haltung oder Verheißung, musikalisch vermittelt und beglaubigt, nicht erzeugt. Der Maximalhorizont, vor dem diese Vermittlung stattfindet, ist die Teilhabe an Gemeinschaften - wobei sowohl die Teilhabe wie die Gemeinschaft auch rein imaginär sein können ( in der Mehrzahl der Fälle sind sie es sogar). Dieser Leiteinfall greift aus der Forschung direkt in die Lehre - an den Universitäten, verlangt Diederichsen, müsse Pop-Musikwissenschaft gegenüber der Musikologie das Gleiche leisten, "was die Filmwissenschaft gegen die Theaterwissenschaft und die Theaterwissenschaft im Kampf mit der Literaturwissenschaft durchsetzen musste: eine qualifizierte Sezession." Bei diesen beiden Disziplinen wurde die jeweilige Fachetablierung allerdings vom Theaterwesen und der Filmwelt insgesamt erzwungen, es gab keinen Einzelkämpfer mit Hauptwerk. Näher als der Vergleich mit jenen liegt daher, will man verstehen, was Diederichsen vorlegt, wohl die Erinnerung an den Sechshundert-Seiten-Brocken "Real Spaces", mit dem der Kunsthistoriker David Summers 2003 den Unterschied zwischen visuellen und nichtvisuellen Künsten abschaffen wollte, um ihn durch ein neues Sortierkriterium zu ersetzen: die Differenz zwischen virtuellen und begehbaren Räumen. Plausibilität dafür stellte Summers dadurch her, dass er die Fülle seines Wissens damit organisierte, also seinen chinesischen Ritualmasken, Proportionen bei Da Vinci und altägyptischen Fresken Auskünfte entlockte, die anders nicht zu haben gewesen wären.
Diederichsen glückt dasselbe mit einer Häufigkeit, die Bewunderung weckt - und bei der nur Beckmesser beanstanden werden, dass die Beispiele nicht aus den Download-Charts kommen: Wenn er die Sorte Klangesoterik, die man an Wummern und Dröhnen heftet, als "Liebesnoise" klassifiziert, bei dem "Spiritualität droht", oder wenn er vom großen Verfremder bereits entfremdeter Klänge, Terre Thaemlitz sagt, dessen wahres Material seien nicht seine Klangfotos, sondern "Verhaltensnormen", dann sind das aus den Beschreibungsformen der Plattenkritik ausgebrütete Erkenntnisküken, die umso neugeborener aussehen, als er nicht einmal stets die Eierschalenreste von ihrem Gefieder ablöst. Wer die Sachen kennt, die er so deutet, findet viele seiner Beweise schlagend, die dartun sollen, dass Pop-Musik Tatsachen einerseits des Gesellschaftlichen und andererseits des Kunstgesetzlichen ineinanderblendet zu etwas, das wohl "sozialästhetische Wirklichkeit" heißen muss. Es ist wie bei der Kognitionswissenschaft, die ja auch eine eigene Disziplin jenseits von sowohl Hirnphysiologie wie Psychologie ist, in der dann einerseits das Elektrochemische und andererseits das psychologisch Erlebnishafte beachtet wird.
Wer Bücher unbedingt paarweise als Thesengefäße gegeneinanderstellen muss, mag Diederichsens Opus mit dem ebenfalls dieser Tage erscheinenden Werk "The Story of Pop" des Musikjournalisten und preisgekrönten Hörspielschaffenden Karl Bruckmaier zusammenpacken. Wo Diederichsen einen Einfall bereist wie einen neuen Kontinent, schreibt Bruckmaier den Atlas einer Kultur als Berichtesammlung.
Auch ihm ist Pop-Musik mehr als ein Haufen Töne, nämlich "ein Drama", das "von einem bestimmten Typus Mensch erzählt, von seinen Lebensumständen, von seinen Träumen, von seinen politischen Ansichten und von seinen Unzugänglichkeiten". Dieses Drama fängt bei ihm früher an als bei Diederichsen, es wird "seit Jahrhunderten" aufgeführt, entspringt unter anderem in New Orleans und hat viel mit dem zu tun, was der britische Erforscher afrikanischer Diasporageschichte, Paul Gilroy, "Black Atlantic" nennt.
Diederichsen würde Bruckmaier da zustimmen - legt aber als Theoretiker der Schnittstellen und Kippfiguren Wert darauf, dass die über den Jazz zur Pop-Musik der Gegenwart führenden Uneigentlichkeiten immer wieder kurzgeschlossen wurden mit sehr verschiedenen Arten der Normabweichung, vom "White Negro" Norman Mailers bis zu Sexualitäten, die nicht in herrschenden (Re-)Produktionsmodi aufgehen.
Pointen mögen und bieten beide; Bruckmaier anekdotische, Diederichsen eher aphoristische. Bruckmaiers Stärke ist die aus der Absage an lehrhafte Systematik gewonnene Freiheit zur Montage; sein Buch ziert ein Foto-Insert von Olaf Unverzart, außerdem gibt es einen digital abrufbaren Popsong zum Text. Dafür zeigt Diederichsens majestätischer Registeranhang dem Infosetzkasten Wikipedia, wie die große weite Welt sprechender Namen und nicht domestizierter Begriffe aussieht. "Dabei" waren sie persönlich ohnehin beide - damit gibt man nicht an, Bruckmaier gesteht Gedächtnislücken, Diederichsen verheimlicht nicht, dass sein erstes Konzert ein Auftritt des nach den meisten heutigen Hipsterkriterien bizarr patinierten Gitarrengottes Johnny Winter war.
Mediengeschichte ist bei beiden eine bloße Hilfswissenschaft - also nicht, wie etwa bei vielen jüngeren publizistischen und akademischen Versuchen, die Filmästhetik zu erneuern, eine Art sicherer Hafen. Das ist sympathisch, zwingt aber vor allem Diederichsen, den Kampf gegen den Kittler in uns allen mit strengen Mitteln zu führen - tabelliert er etwa verschiedene "Kulturindustrien" für verschiedene Zeitabschnitte, dann sieht es so aus, als glaubte er, das Neue löse das Alte im Bereich der materiellen Rahmenbedingungen tatsächlich rückstandslos und endgültig ab. Hier wirkt sich die im Buch nicht explizit artikulierte, aber für das ganze Unternehmen lebensnotwendige Annahme aus, das Sozialästhetische (samt Politik) sei seinen Trägertechniken in gewissem Sinne logisch vorgeordnet. Der Gedanke "Was weg ist, ist weg, und darüber, ob was weg ist, entscheidet soziale Praxis, nicht Technik, die schnell überholt ist" dürfte auch verantwortlich sein für Behauptungen wie: "Authentizismus und Rock-Theater sind schon lange keine Optionen mehr." Nun ja, Diederichsen muss nicht das Magazin "Rock Hard" lesen, wenn es ihn langweilt, aber was da stattfindet, hält sich an den Satz nicht und ist doch nach allen anderen Bestimmungen des Denkers eindeutig Pop-Musik.
Seit dem Phonographen und dem Radio lautet die technische Wahrheit eben nicht "Ersetzung", sondern Gleichzeitigkeit von erstens immer neuen klanglichen Nachrichten (Radio) und zweitens Abrufbarkeit von Archiven (Plattensammlung plus Plattenspieler) - bis tief in die Computernetze. Dass manche Sätze bei Diederichsen so gucken, als habe er ihnen aufgetragen, das zu bestreiten, schadet aber nichts - das Buch als Ganzes weiß es besser und entzückt damit, dass es sich von seinem Anspruch, Gültiges über Wirkliches auszusagen, auch das Werten nicht verbieten lässt: Einmal steht in einer Aufzählung verschiedener Musikstile "Barbershop" neben "Narzissten-Folk".
Hier spricht der Kritiker, denn das zweite Wort hat er urteilend erfunden: Es gibt zwar Leute, die sagen, "ich spiele (oder genieße) Barbershop" (Homer Simpson zum Beispiel), aber den Satz "Ich liebe meinen Narzissten-Folk" gab es bislang nicht. Dass Diederichsen solche Wertungen vornimmt, ist ein erfreuliches Zeichen seines Widerstands gegen einen heiklen Umstand: dass kein "Fortschritt" und auch nicht sein Gegenteil, die Regression, noch in einer Lage steckt, deren Geräte und Sozialästhetiken die Gleichzeitigkeit klanglicher Neuigkeiten einerseits und umfassenden Archivzugriffs andererseits verwirklichen. Wo Daten nicht mehr von Wertungen geordnet werden, wird selbst Chronologie tendenziell suspendiert - dem Arbeitsspeicher ist es egal, ob er das Alte vergisst oder das Neue, ob er geschichtslos ist oder nostalgisch.
Die Menschen aber, die Pop-Musik machen und genießen, leben immer noch chronologische Biographien - "Man wird nicht jünger", schreibt Diederichsen, und einige Missmutigkeiten Bruckmaiers gegen Hiphop oder Miley Cyrus weisen in dieselbe Richtung. Kann man schon das Ende sehen? Diederichsen probiert es: "Wenn Hegel in seiner Geschichtsphilosophie für die Kunst ein komisches Ende erwartete, dann wäre für das Schicksal der Pop-Musik womöglich ein Ende in Seriosität zu antizipieren: ein unkomisches Ende." Wenn die sozialästhetischen Verweisketten zerbröseln, mag aus etwas, das mehr und etwas anderes war als Musik, eine Form von Staub werden, die wieder "Musik" heißen wird.
Was passiert dann mit dem, was darüber geschrieben wurde, als es um mehr und anderes ging? Was werden das für Artikel, Essays, Bücher gewesen sein?
Bruckmaiers "Story of Pop" sucht und findet den Anschluss an Vorbilder, an Texte von Kritikern wie Lester Bangs oder Nik Cohn. Diederichsens "Über Pop-Musik" aber wird, wenn die Kämpfe gewonnen oder verloren sind, in denen er mitredet, das sein, was - um ein paar Verwandte zu grüßen - Adornos "Altern der Neuen Musik", Dan Grahams "Rock my Religion" oder Cornelius Cardews "Stockhausen Serves Imperialism" heute schon sind: schöne, spröde, ohne Gefälligkeiten parteiliche Literatur.
Karl Bruckmaier: "The Story of Pop".
Murmann Verlag, Hamburg 2014. 352 S., geb., 29,99 [Euro].
Diedrich Diederichsen: "Über Pop-Musik".
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2014. 474 S., geb., 39,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Der Titel von Karl Bruckmaiers "The Story of Pop" ist missverständlich, warnt Julian Weber, denn es geht dem Autor mitnichten um eine Erzählung über die angloamerikanische Popmusik, jedenfalls nicht im engeren Sinne. Bruckmaier schreibt vielmehr über verborgene Kontinuitäten in der Popmusik, die rückblickend kulturelle Grenzen verwischen, er schreibt über die Einflüsse des afroamerikanischen Jazz, über den persischen Musiker Zyriab, der im neunten Jahrhundert lebte und großen Einfluss auf die nordafrikanische und die iberische Musik hatte und über die Tropicana-Bewegung in Brasilien, fasst Weber zusammen. Pop sei "per definitionem in Bewegung", er befreie die Körper und diene der "Umwidmung einer totalitären Sicht auf das Leben in humane Alternativen", zitiert der Rezensent Bruckmaier, und in dieser Hinsicht sei das Buch selbst eine "schriftliche Nachahmung von Pop-Aufsässigkeit", meint Weber.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH