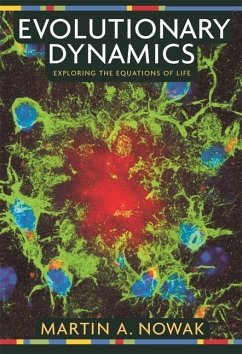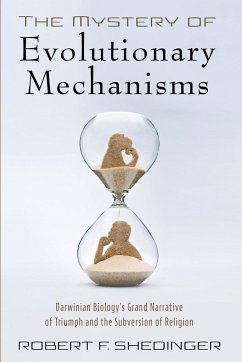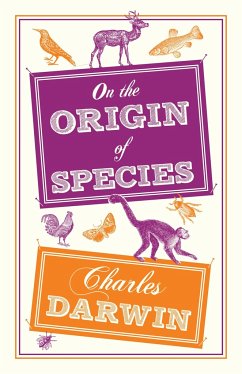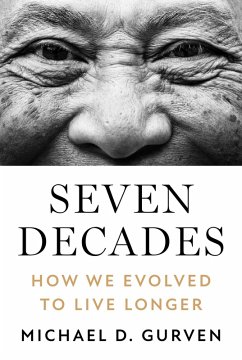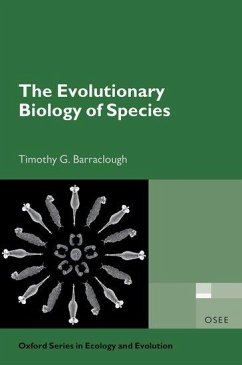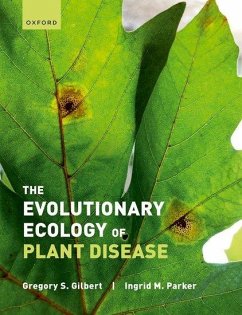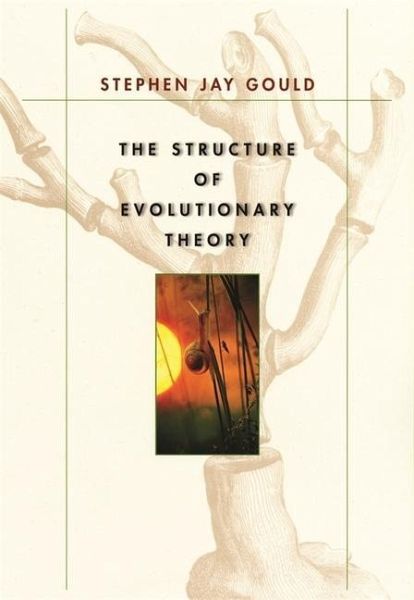
The Structure of Evolutionary Theory
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
88,99 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
44 °P sammeln!
This volume describes the content and discusses the history and origins of the three core commitments of Darwinism, examines the three critiques that challenge this Darwinian edifice and proposes a system for integrating these commitments and critiques into a structure of evolutionary thought.