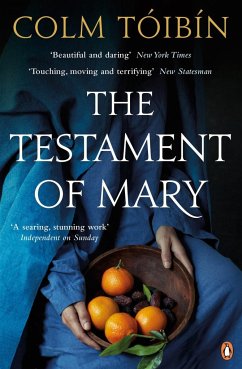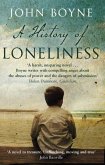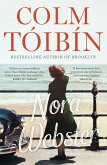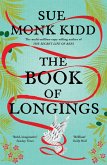Die Geschichte Marias, wie sie die Bibel nicht erzählt: Lange Jahre, nachdem Christus am Kreuz gestorben ist, will die Mutter Jesu von der Heiligkeit ihres Sohnes noch immer nichts wissen. Seinen Wundern gegenüber ist sie skeptisch und den Schmerz über seinen Verlust hat sie nie überwunden. Dann erzählt sie ihre eigene Version von der Passion Christi von ihrer ganz persönlichen Trauer, ihrer fehlenden Frömmigkeit und ihrem Eigensinn. Es ist die Geschichte einer Frau, die nicht verstehen will, weshalb ihr Sohn sich von ihr abwandte, und die auch nicht an den christlichen Gott glaubt. Durch ihre Augen eröffnet Colm Tóibín einen völlig neuen Blick auf das Christentum und erschafft ein ungeahnt menschliches Porträt der Ikone Maria.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Maria ist bei Colm Tóibín nicht die Mutter Gottes, sondern die Mutter eines Sohnes, der einen fürchterlichen Tod stirbt, eine Frau, die an Erlösung nicht glaubt.
Von Verena Lueken
Keine Frau, von der wir ein deutlicheres Bild haben als von Maria. Keine Frau, die häufiger dargestellt wurde als sie, die Mutter Gottes, wie die Christen sagen, in Verkündigungsszenen, mit dem Jesuskind, bei Grababnahmen und in der Pietà. Sie ist die Ikone eines Glaubenssystems, aber wir wissen nahezu nichts von ihr.
Wer war sie? Das ist die Frage, die Colm Tóibín in "Marias Testament" umtreibt. Nicht, weil er Gott eine Mutter mit deutlicheren Konturen geben möchte, sondern weil er wissen will: Wo ist die Mutter in der Geschichte des Sohnes?
Auf einer Strecke von nur 127 Seiten erschafft Tóibín eine Frau, von der wir trotz all der Darstellungen keine Vorstellung hatten. Wer dieses Buch gelesen hat, wird auf ihre Bildnisse mit anderem Blick schauen. Hier ist sie eine alte Frau, die den Tod erwartet, nicht ungeduldig, aber ohne Furcht und am Ende mit der Sehnsucht, "in der trockenen Erde zu schlafen, mit geschlossenen Augen friedvoll zu Staub zu zerfallen". Eine ungeheure Müdigkeit liegt in diesem Satz.
Maria lebt in Ephesus in einem Haus, in dem sie von zwei Männern bewacht und ausgefragt wird, ehemaligen Jüngern zweifellos, möglicherweise Matthäus und Johannes, aber das spielt keine Rolle. Die beiden stellen Fragen, um das Leben des Sohnes und vor allem sein Sterben in eine Form zu bringen, die unmittelbar ist und mythenfähig. Maria hat sie vollkommen durchschaut. Und sie erzählt ihnen nicht, was sie wissen wollen. Weil es ganz anders war.
"Du warst da", sagen die beiden. Aber Maria war nicht da, als ihr Sohn starb. Nicht in Tóibíns Version der Geschichte. Da floh Maria, bevor ihr Sohn tot war, um sich zu retten. Sie spürte in ihrem Kummer, ihrem Entsetzen genau, dass es seine Schmerzen waren, die er am Kreuz herausschrie, und dass sie die ihm nicht nehmen konnte. Sie ertrug andere Schmerzen. Und sie ging, solange dafür noch Zeit war. Sie wundert sich, wie beherrscht sie war. Sie nahm ihn nicht vom Kreuz, und sie wusch ihn nicht. Auch bei der Auferstehung war sie nicht dabei. Von ihr hat sie später geträumt, wie die andere Maria auch, die mit ihr geflohen war.
In Tóibíns Sätzen spürt man die Landschaft, die Hitze, den Staub und auch die Zeit, die zwischen uns und der Welt liegt, in der diese Frau lebte, mehr als zweitausend Jahre von uns entfernt. Es sind einfache Wörter, einfache Sätze, in denen Tóibín erzählt, und man ist versucht, sie biblisch zu nennen, wenn das nicht fromm hieße, sondern: seit langem vorbei.
Wir spüren die Zeit in den Metaphern, die er wählt, darin, wie er die Angst beschreibt, mit der Maria sich auf den Weg zu ihrem Sohn macht, der, wie sie weiß, gekreuzigt werden wird, eine Art zu sterben, die sie einmal beobachtet hatte, als die Römer einen der Ihren ans Kreuz hängten. Sie hatte gehofft zu sterben, ehe sie noch einmal eine derart "düstere Grausamkeit" erleben musste. Es gibt Augenblicke, in denen Maria entfällt, was bevorsteht, aber dann bemerkt sie, "dass das, worauf ich mich zubewegte, nur darauf wartetete, mich anzuspringen, so wie ein erschrecktes Tier einen anspringt.
Genauso kam es, in plötzlichen Sätzen und Sprüngen. Und dann wieder langsamer, heimtückischer. Es drang in mein Bewusstsein, schlich sich in mich ein, so wie ein giftiges Tier auf einen zukriecht." Giftige Tiere, erschreckte Viecher - das könnte in der Wüste sein, in dem Marktgewimmel in Jerusalem, in das Menschen ihre Tiere mitbringen, sie mit anderen Tieren füttern, schlachten, verspeisen, so wie der Mann, der einen Raubvogel in einem Käfig bei sich hat, den er aus einem Sack voller lebendiger Kaninchen füttert.
Dies ist ein unglaubliches Buch. Es erzählt eine Geschichte, die wir noch nie gehört haben, obwohl die Markierungspunkte uns sämtlich bekannt sind. Die Gier der Menschen nach Blut, als Pilatus einen der Verurteilten begnadigt, Barabas. Die Heimtücke der Verräter, die am Rand stehen und Maria beobachten. Die Gleichgültigen, die Würfel spielen - es ist, als beschriebe Tóibín auf besonders luzide Weise (und ebenso übersetzt von Giovanni und Ditte Bandini) alle Details auf einem besonders grausigen Kreuzigungsbild etwa von Lucas Cranach, und zwar in Bewegung gesetzt, in einer ungeheuren Dynamik, in der das Keuchen der Menge, das Geschiebe, das Ansteckende der Blutgeilheit, all dieses spürbar wird im atemlosen Weiterpreschen der Wörter und Sätze, so weit, bis die aufgepeitschte Menge selbst Pilatus in Schrecken versetzt.
Maria erzählt diese Geschichte, als ihr Sohn, dessen Namen sie nie ausspricht längst tot ist. Sie verlangt noch etwas von der Welt. "Nicht viel, aber mehr." Die Zeit zurückzudrehen: "Ich will noch einmal leben, bevor sich meines Sohnes Tod ereignete." So einfach ist das. Die Welt unerlöst zu lassen. Es war die Sache nicht wert. Wer ist die Welt, dass sie durch den Tod des Sohns erlöst werden will?
Erlösung - dieses Wort, um das die ganze Geschichte, wie sie sonst immer erzählt wird, kreist und an das Maria nicht glaubt, fällt zum ersten Mal auf Seite 82. Maria ist keine Gläubige, keine Anhängerin der Lehren ihres Sohnes, von dem sie wünschte, er hätte sich nicht mit dieser "Bande" von Männern umgeben, die an seinen Lippen hingen und ihrerseits mit hochtrabenden Sprüchen nicht sparten, einer "Horde", die wie in einem Karnevalszug mit ihm durchs Land reiste. Sie erlebt die Macht, die ihr Sohn auf die Menschen hat, auch wenn sie diese selbst nicht spürt, weil in ihr ein anderes Gefühl stärker ist.
Denn sie stellt fest, dass sie diesen Sohn, der sie bei der Hochzeit in Kana nicht beachtet, der sie wegstößt, als sie ihn vor seinen Häschern warnen, mit ihm fliehen will, dass sie diesen Sohn mehr liebt als zuvor - "einen Mann voller Macht, einer Macht, die scheinbar keinerlei Erinnerung an frühere Jahre zuließ, da er die Milch meiner Brust brauchte, meine Hand, die ihm beim Laufenlernen half, das Gleichgewicht zu bewahren, oder meine Stimme, die ihn in den Schlaf wiegte. Und das Seltsame an der Macht, die er ausstrahlte, war die Tatsache, dass durch sie meine Liebe zu ihm und mein Wunsch, ihn zu beschützen, tiefer wurde als zu der Zeit, als er noch keine Macht besessen hatte." Tóibín erzählt von der Tragödie, dass sie ihn nicht beschützen konnte.
Colm Tóibín: "Marias Testament". Roman.
Aus dem Englischen von Giovanni und Ditte Bandini. Carl Hanser Verlag, München 2014. 127 S., geb., 14,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Beguiling and deeply intelligent...In a single passage - and in a rendition, furthermore, of one of the most famous passages of western literature - Tóibín shows how the telling and the details are all-important. Robert Collins Sunday Times