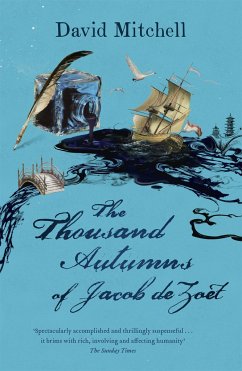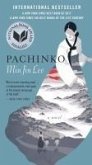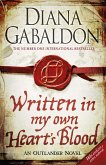Wenn man in englische Buchgeschäfte geht und sich die Klappentexte der feilgebotenen Ware durchliest, wird man schnell ganz aufgeregt und auch verwirrt. Es ist alles so verlockeeeendddd! "Mesmerizing" steht da, oder "A dazzling work of fiction", oder "A true page turner", oder "The best book I have read in years". Gezeichnet: "New York Review of Books", "International Herald Tribune". Es wird im Akkord phantastische Literatur produziert in der englischsprachigen Welt, denkt man. Und stellt dann enttäuscht fest, dass dort eher einfach nur gelobt wird wie Sau.
Auf der Rückseite der englischen Ausgabe von "Jacob de Zoet" stand nun im Namen der "New York Times", dass der Autor, David Mitchell, "eindeutig ein Genie" sei. Wow!!! Bei so viel Lob ist erst recht Vorsicht geboten. Zumal Mitchell wegen der Verfilmung seines Buchs "Cloud Atlas" ohnehin gerade auf dem Gipfel der Hysterie steht. In den Filmrezensionen des McDonald's-Magazins oder ähnlichen Blättern unseres Vertrauens steht zum Beispiel, dass "Cloud Atlas" so gut wie unmöglich zu verfilmen gewesen sei, weil, total Avantgarde, wie da verschachtelt wird in der Chronologie, pyramidale Erzählstruktur oder so. Dann aber, wenn man trotz aller Vorsicht mit "Jacob de Zoet" anfängt und plötzlich auch fertig ist, fragt man sich doch: Was ist eigentlich los mit diesen Engländern und Amerikanern, dass die so gut sind darin, Geschichten zu erzählen? Dass die irgendwie noch so an die Geschichte an sich glauben, statt nur elenden Metascheiß zu produzieren? Und was ist los mit Mitchell, dass er das so extra gut kann, dass man selbst hingerissen ist zu sagen: "mesmerizing, a true page-turner"? Ist der vielleicht wirklich ein Genie?
In "Die tausend Herbste des Jacob de Zoet" gibt es eine Passage, in der zwei japanische Mönche, die einem unsagbar bösen Shinto-Kult des frühen 19. Jahrhunderts angehören und nachts auf den Fluren eines tief in den Bergen gelegenen, eingeschneiten Klosters gerade von einer entführten Samuraitochter belauscht werden, über die Frage reden, was gutes Erzählen ausmache. Am Ende erklärt der ältere Mönch, der hervorragende Geschichten schreibt, das sei im Grunde bloßes Handwerk. Sicherlich beherrscht David Mitchell sein Handwerk. Held, Bösewicht, Ziel, Widerstand und so weiter. Aber das kennt man ja von anderen Autoren auch und ist bei denen doch gelangweilt. Mitchells Geschichte, die damit beginnt, dass ein niederländischer Pfarrerssohn im Jahr 1799 auf einen Handelsposten vor Nagasaki kommt, ist in ihrer ständigen Folge von Enthüllungen und Wenden, in ihrer immer weiter wachsenden Geschwindigkeit, in der Art, in der der Blick in den Kopf einer neuen, wieder superlebendigen Figur alles vorher Geschehene in ein neues Licht taucht, aber so gut gebaut, dass man an die These vom Handwerker nicht so recht glauben kann. Der Autor ist vielmehr wohl wirklich begnadet.
Als Warnung sei noch gesagt, dass das Buch sehr, sehr teuer ist, denn nach der Lektüre zückt man sofort die Kreditkarte und bucht den nächsten Flieger nach Japan, so eindrücklich beschreibt der Autor, wie dort alles anders, vor allem aber besser ist als bei uns.
Alard von Kittlitz
David Mitchell: "Die tausend Herbste des Jacob de Zoet". Rowohlt, 720 Seiten, 19,95 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Spectacularly accomplished and thrillingly suspenseful . . . it brims with rich, involving and affecting humanity Sunday Times